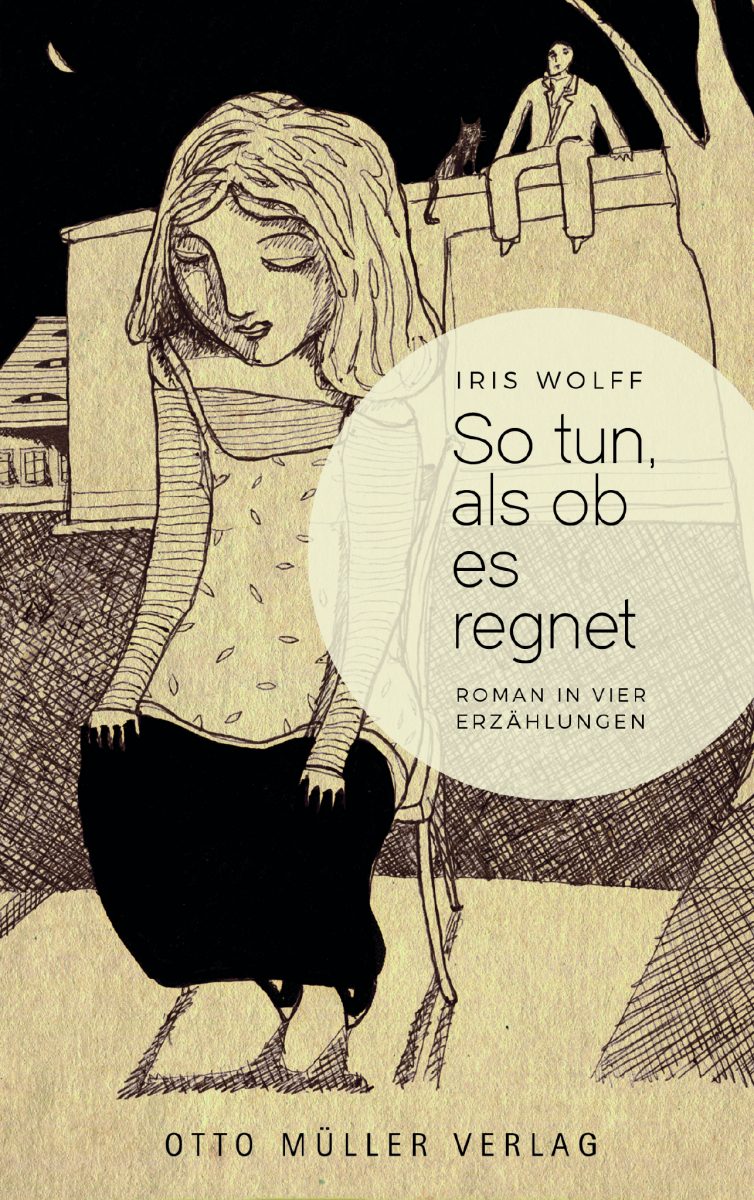Familie – oder was man dafür hält
Iris Wolff über Leerstellen und Brüche in einer Familiengeschichte
Was ist eigentlich eine Familie? Was verbindet jene, die zu einer Familie gehören? Und was trennt sie? Diesen großen Fragen nähert sich Iris Wolff in „So tun, als ob es regnet“ über die scheinbar kleine Form eines „Roman[s] in vier Erzählungen“. Im Idealfall zeigt sich bei dieser Erzählform im Fragmentarischen das Zusammengehörende, im Ausschnitthaften das allgemein Gültige. Den Klassikern des Genres, wie Sherwood Andersons „Winesburg, Ohio“ (1919), genügen nur wenige Seiten, um dramatische Konflikte von epischer Breite darzustellen. In großer Verdichtung wird unmittelbar sichtbar, was die handelnden Figuren ausmacht, was sie antreibt, erlöst oder vernichtet. Das zwischen den „Stories“ entstehende Beziehungsgeflecht ergibt sich bei Anderson aus dem Ort der Handlung, einer amerikanischen Kleinstadt. Bei Wolff hingegen ist Familie das vier Generationen und zeitliche Stationen verbindende Moment und dabei insbesondere auch die Zugehörigkeit dieser Familie zur deutschsprachigen Minderheit in Rumänien, den Siebenbürger Sachsen.
Der Roman setzt ein im Kriegswinter 1916/17. In der letzten Nacht seines kurzen Aufenthalts im rumänischen Dorf Talmesch schläft der österreichische Soldat Jacob mit Alma, der Frau seines Gastgebers. Die in dieser Nacht gezeugte Henriette „fiel auf, weil sie oft allein war und sich seltsamen Dingen widmete“, so ihr Großvater. Zu den nächtlichen Treffen der „Gesellschaft der Schlaflosen“ in seinem Garten – wir schreiben das geschichtsträchtige Jahr 1933 – kommt Henriette als einzige Frau. Henriettes Sohn Vicco interessiert sich 1969 vor allem für Mädchen und die erste Mondlandung. Seine Mutter erscheint ihm hingegen fremd und schwer fassbar. Wie ein Schatten aber liegt über allem die Bedrohung der rumäniendeutschen Minderheit durch das Regime Ceaușescus und die beginnende Migrationswelle nach Deutschland. In der Gegenwart erinnert sich schließlich Viccos auf den Kanaren lebende Tochter Hedda, wie sie als Kind mit ihrer Großmutter Henriette jenes Dorf in den Bergen besuchte, in dem diese 1945 vor sowjetischer Deportation Schutz suchte. Erst jetzt als Erwachsene, so scheint es, versteht Hedda, dass ihr Vater Vicco das Kind aus einer Vergewaltigung Henriettes in diesem Dorf ist.
Diese hier zusammenhängend wiedergegebene Handlung erschließt sich beim Lesen nicht auf den ersten Blick. Da jede der vier Erzählungen von „So tun, als ob es regnet“ eine unterschiedliche Hauptfigur und Handlungszeit hat, sind die Lesenden zur Mitarbeit aufgefordert. Es ist wie das Zusammensetzen eines Puzzles, zu dem man keine Bildvorlage hat und dessen Teile auf verschiedene Schachteln aufgeteilt sind. Es dauert, bis man etwas erkennen kann. Doch handelt es sich bei diesem romanästhetischen Verfahren keineswegs um erzähltechnische „l’art pour l’art“. Vielmehr spiegelt sich darin die Verfasstheit der Romanfiguren. Auch sie kennen nicht alle Teile ihres Lebens- und Familienpuzzles. So ähnelt Henriette in Charakter und Verhaltensweisen ihrem Onkel. Doch da sie ihren Vater nicht kennt, weiß sie davon so wenig wie vom Selbstmord ihres Onkels kurz vor ihrer Zeugung. Lehren aus der Familiengeschichte zu ziehen, ist so nicht möglich. Die Kontinuitäten innerhalb der Familie werden zwar für die aufmerksam Lesenden sichtbar. Die Figuren hingegen erahnen nur vage, dass ihre Leben von Brüchen, Lücken und Leerstellen der Familiengeschichte bestimmt werden.
Der nahezu biblischen Größe dieser zentralen Motivik entspricht der Ton von „So tun, als ob es regnet“. Er stammt aus der Echokammer des Zeitlosen, Märchen- und Legendenhaften und erinnert ein wenig an Joseph Roth. Deshalb stört es, wenn so mancher Satz unfreiwillig die Poetik des Textes unterläuft: „Sie umfasste seine Hand, und es war diese körperliche Nähe, die Vicco den Rest gab.“ Von solchen Stilbrüchen abgesehen ist „So tun, als ob es regnet“ aber ein sehr anregender und stimmiger Roman, der mit erzählerischen Mitteln aufzuzeigen vermag, was Familie ist – oder was man dafür hält.