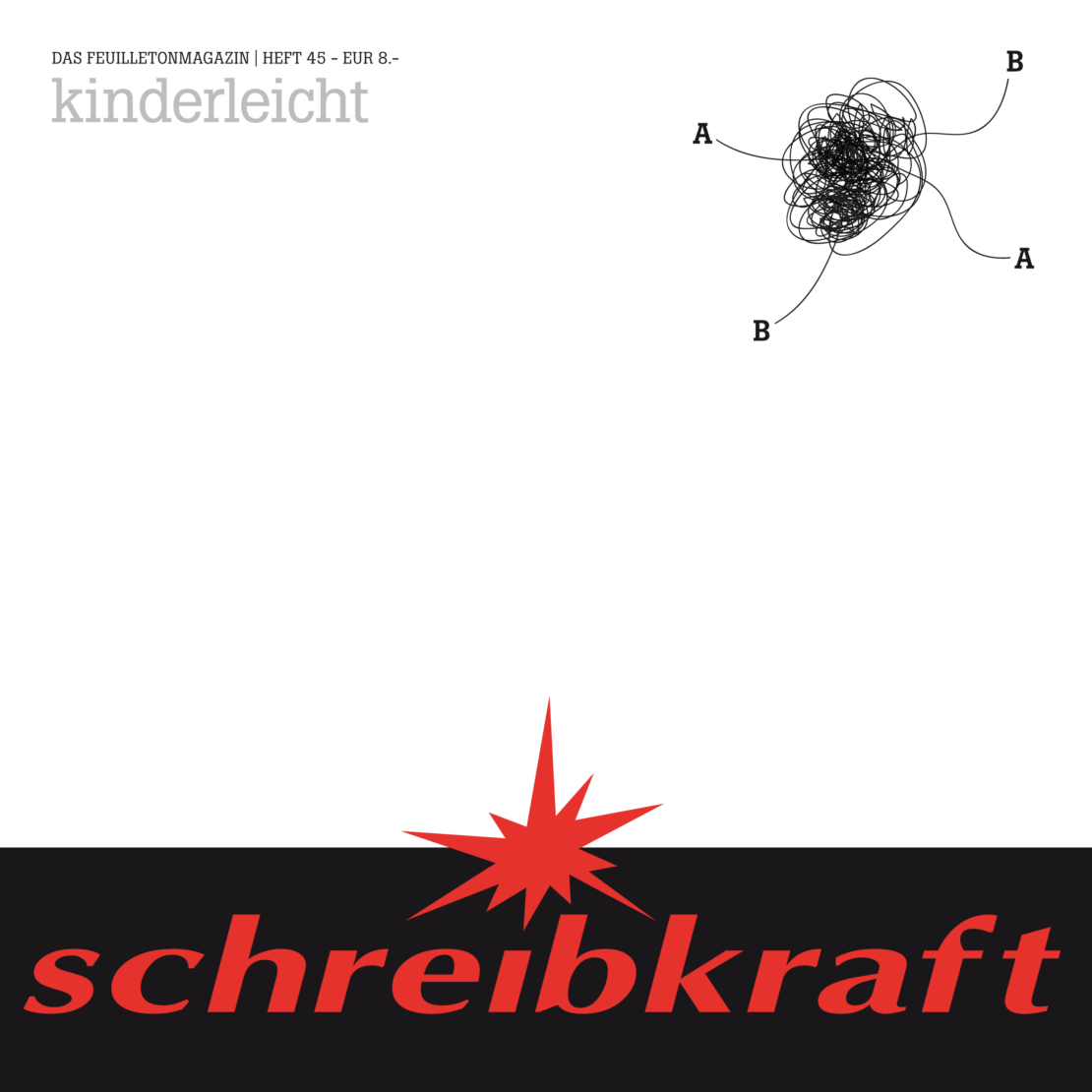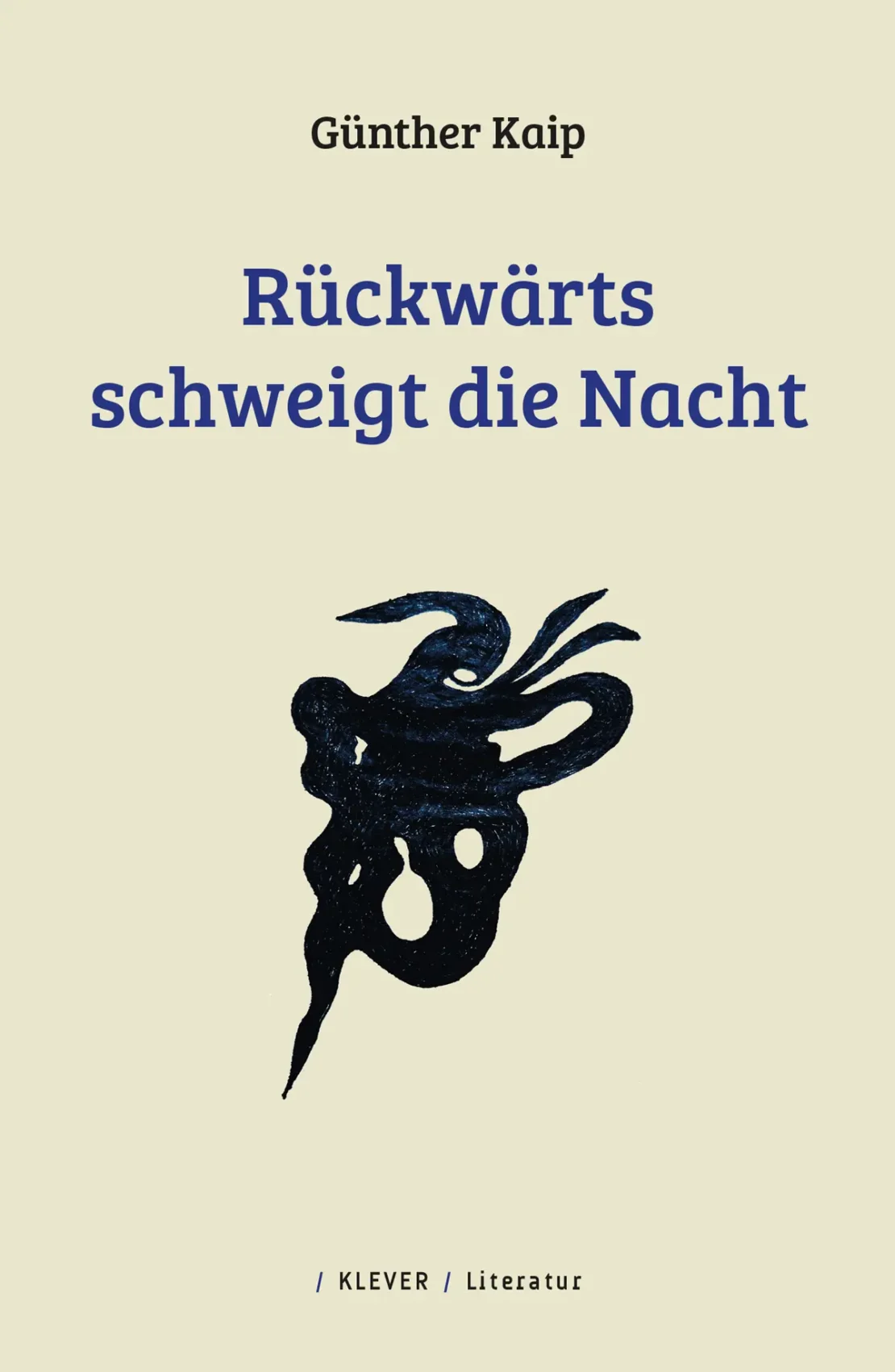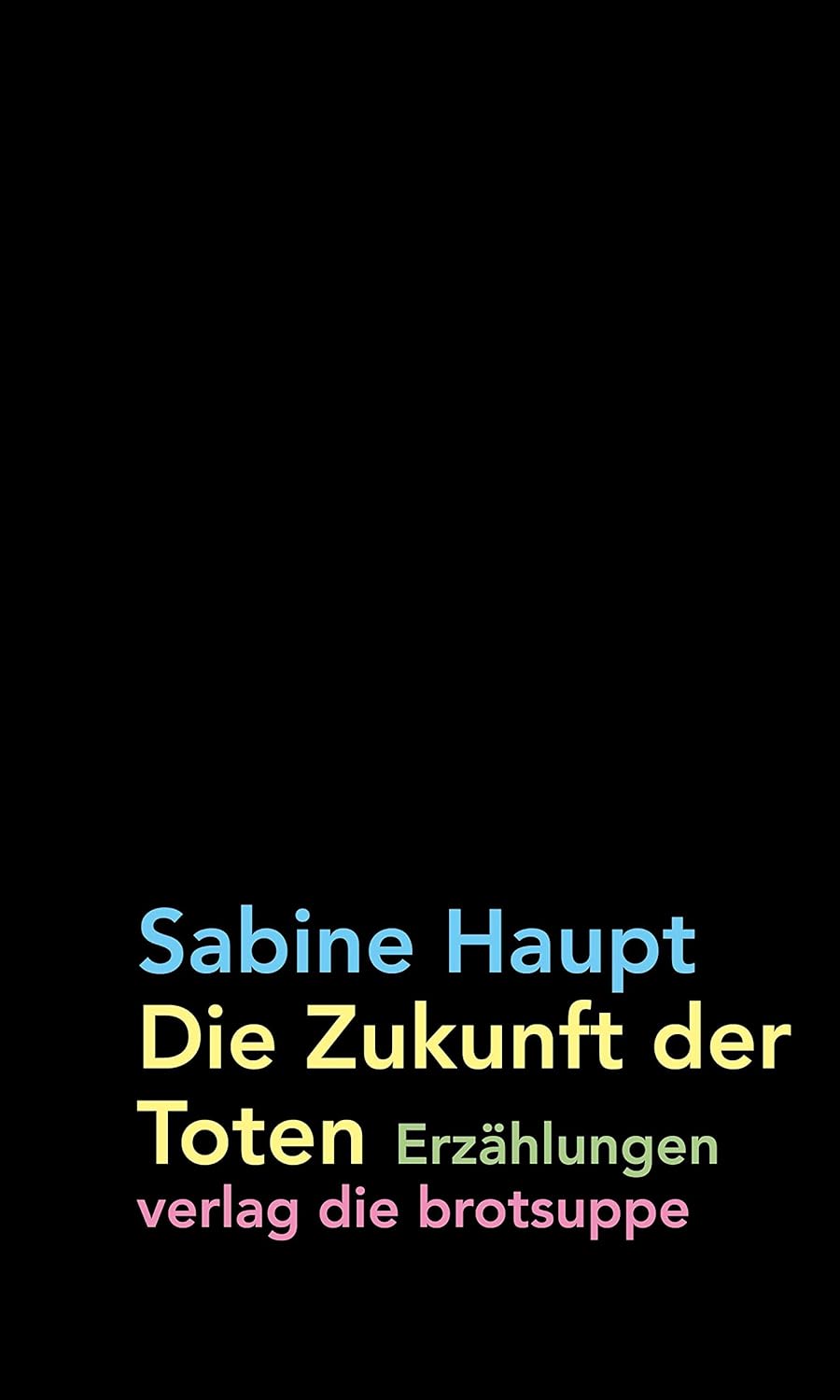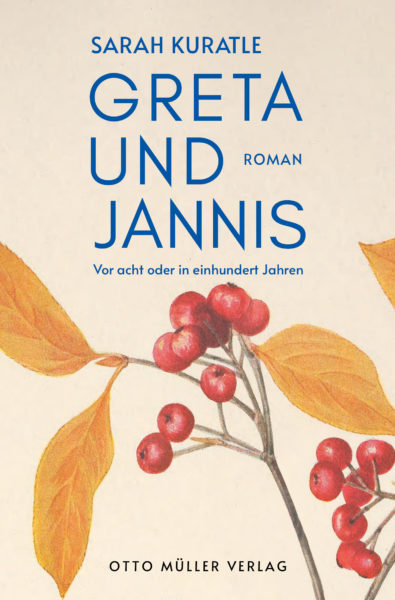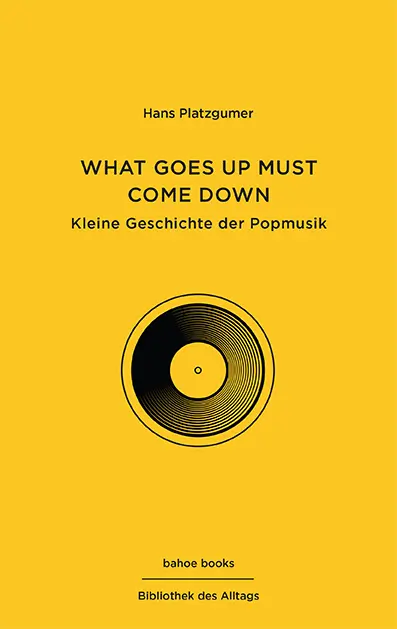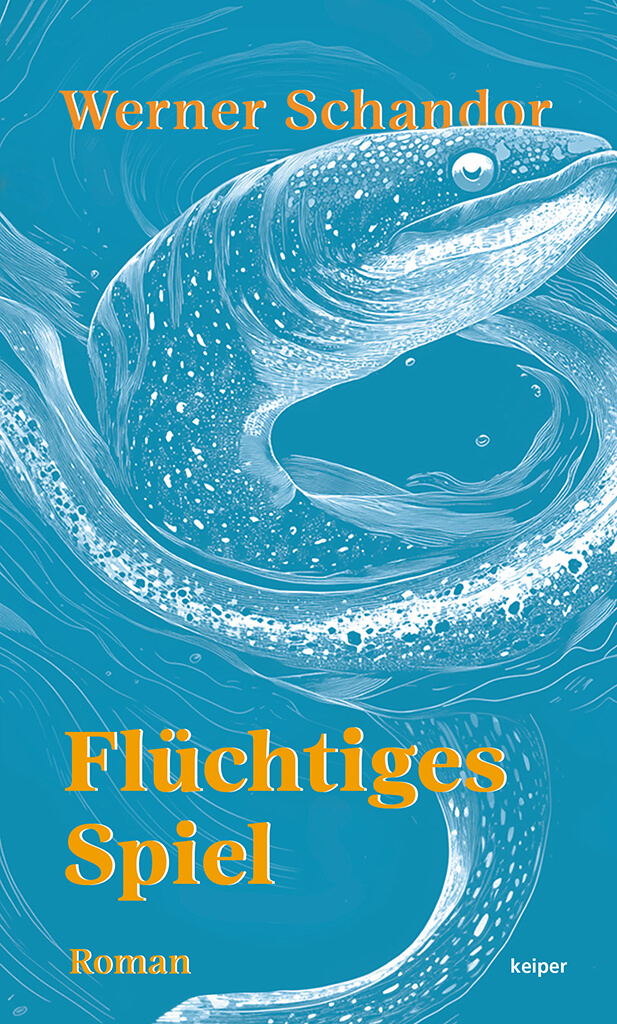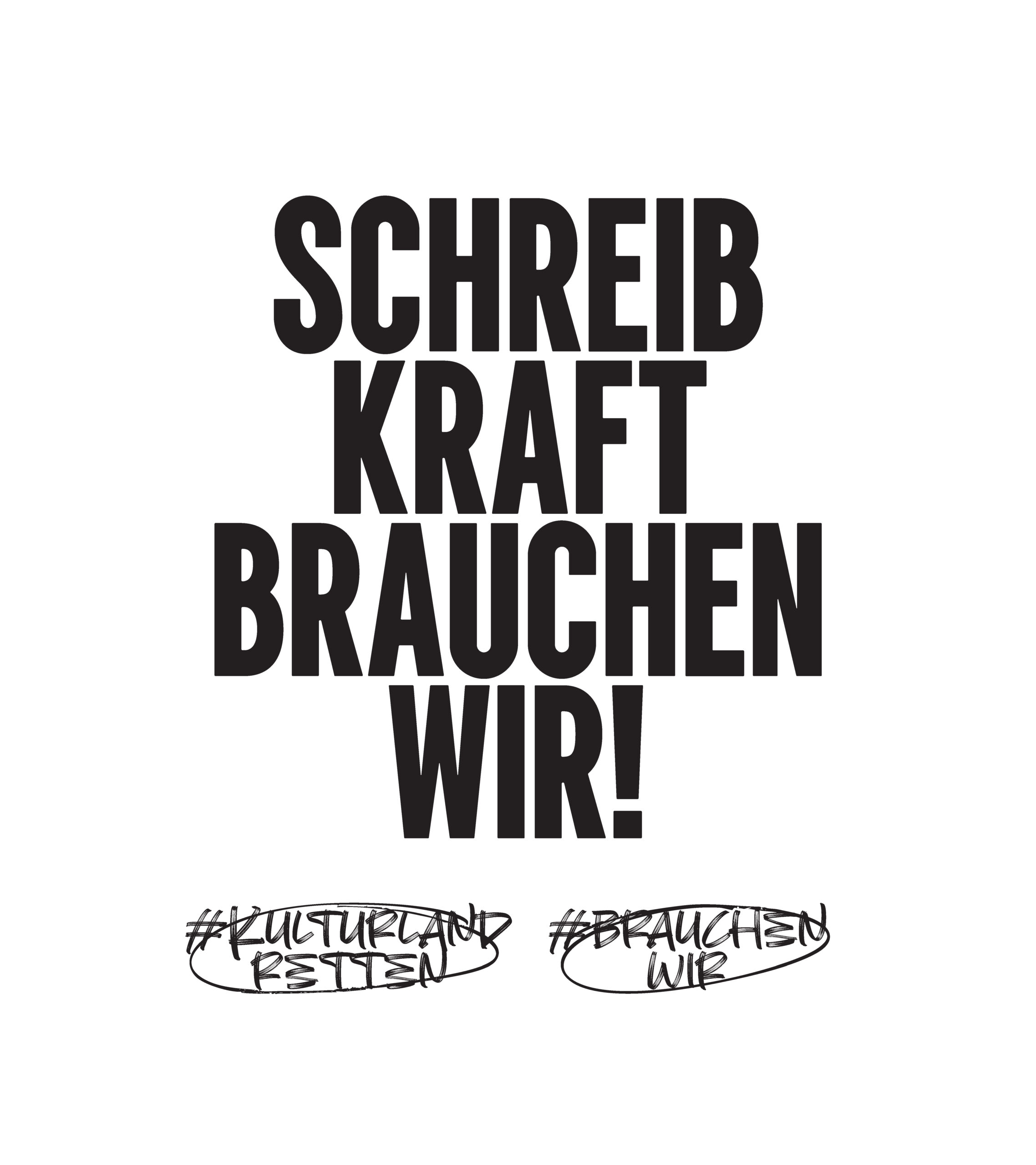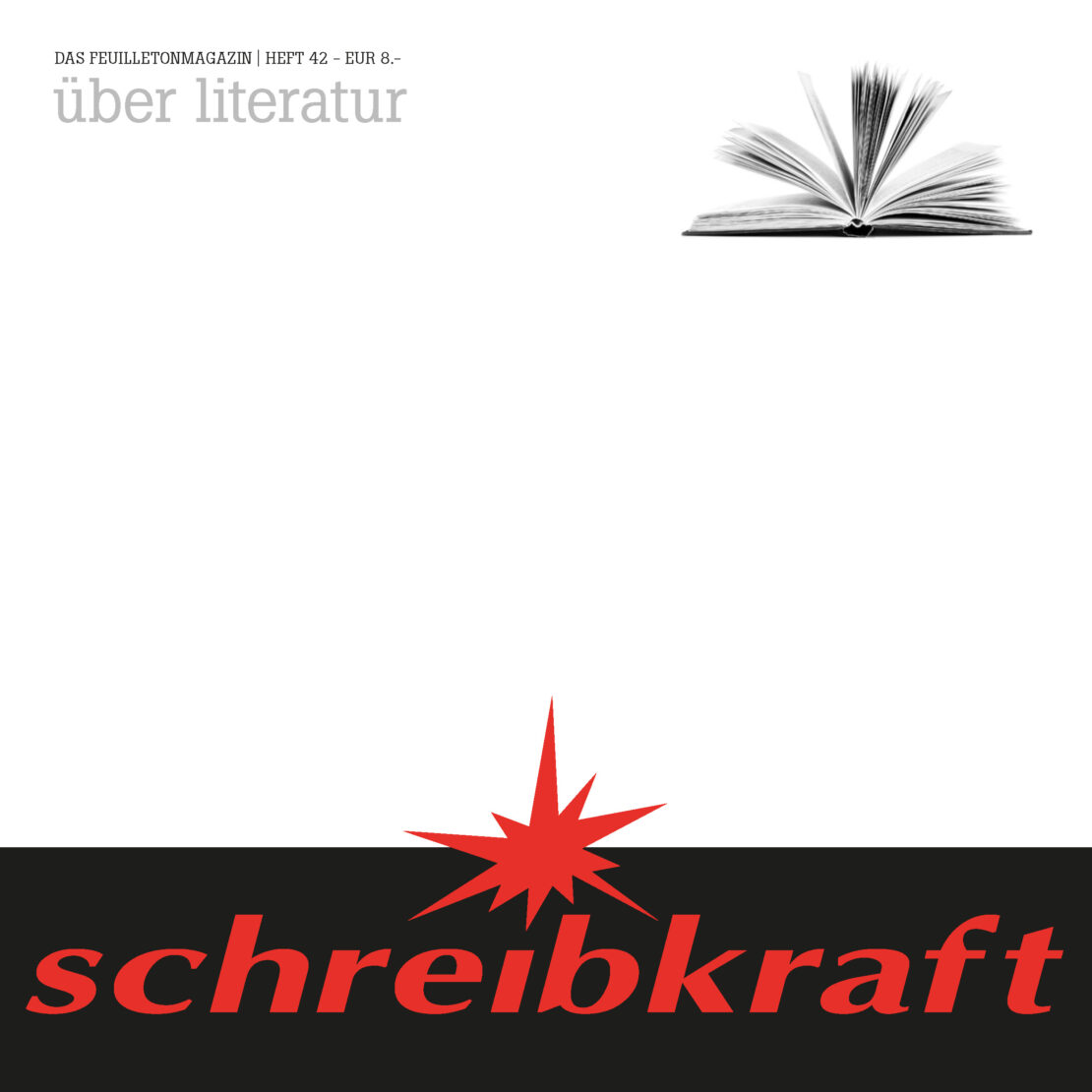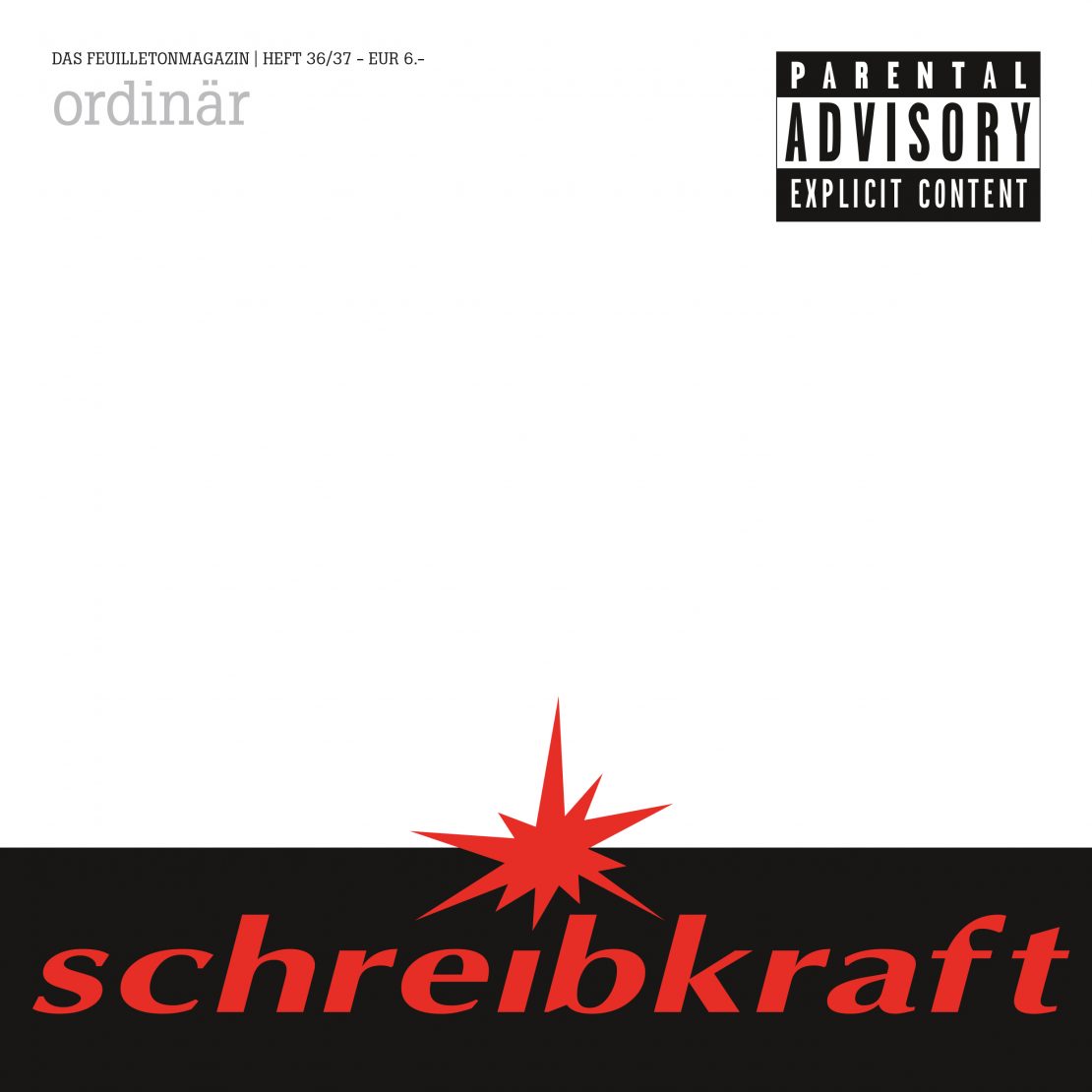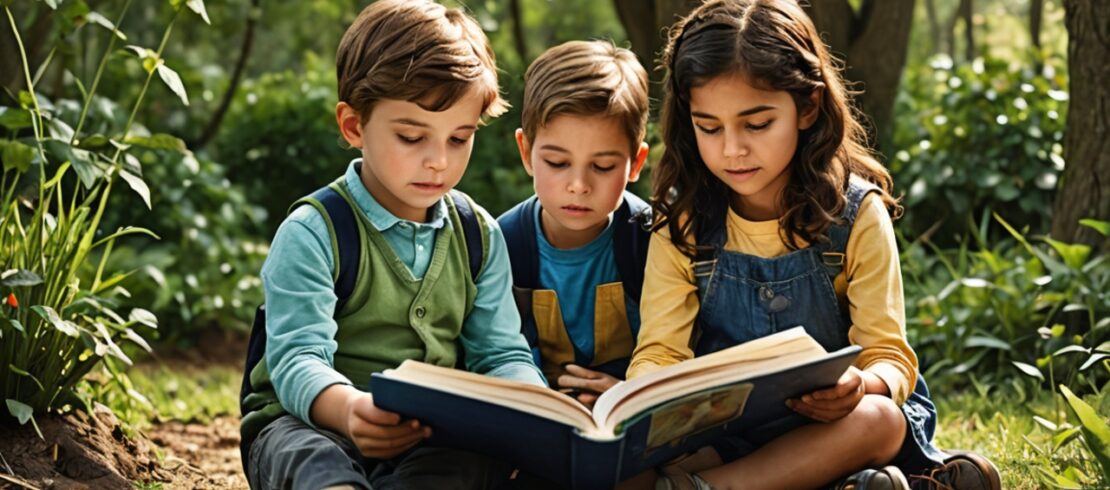
kinderleicht
„In einer Zeit, in der Fundamentalismen aller Couleurs immer mehr um sich greifen und die eigene Privilegiertheit als deutliches Zeichen besonderer Vortrefflichkeit gesehen wird, ist die Literatur gefordert, andere Lebenswelten zugänglich zu machen.“
(Renate Welsh)

nachgefragt
„Der Tanz am Vulkan ist eine Variante des mittelalterlichen Totentanzes. Wer auf dem Vulkan tanzt, kennt die Gefahr, die droht, oder könnte sie kennen und etwas unternehmen. Im Totentanz hingegen fügt sich der Mensch der Einsicht, dass das Leben endlich ist.“
(Thomas Wolkinger)
Rezensionen
Buch
Werner Fiedler:
Werner Fiedler:
Die Apokalypse des frommen Jakob
2024: edition kürbis, S. 243
rezensiert von Hermann Götz
rezensiert von Hermann Götz
Buch
Kulturinitiative Kürbis Wies (Hg.):
Kulturinitiative Kürbis Wies (Hg.):
Der Mann, der sich weigert, die Badewanne zu verlassen
2022: Edition Kürbis, S.
rezensiert von Hermann Götz
rezensiert von Hermann Götz
Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Heft erwerben?
Anfrage senden