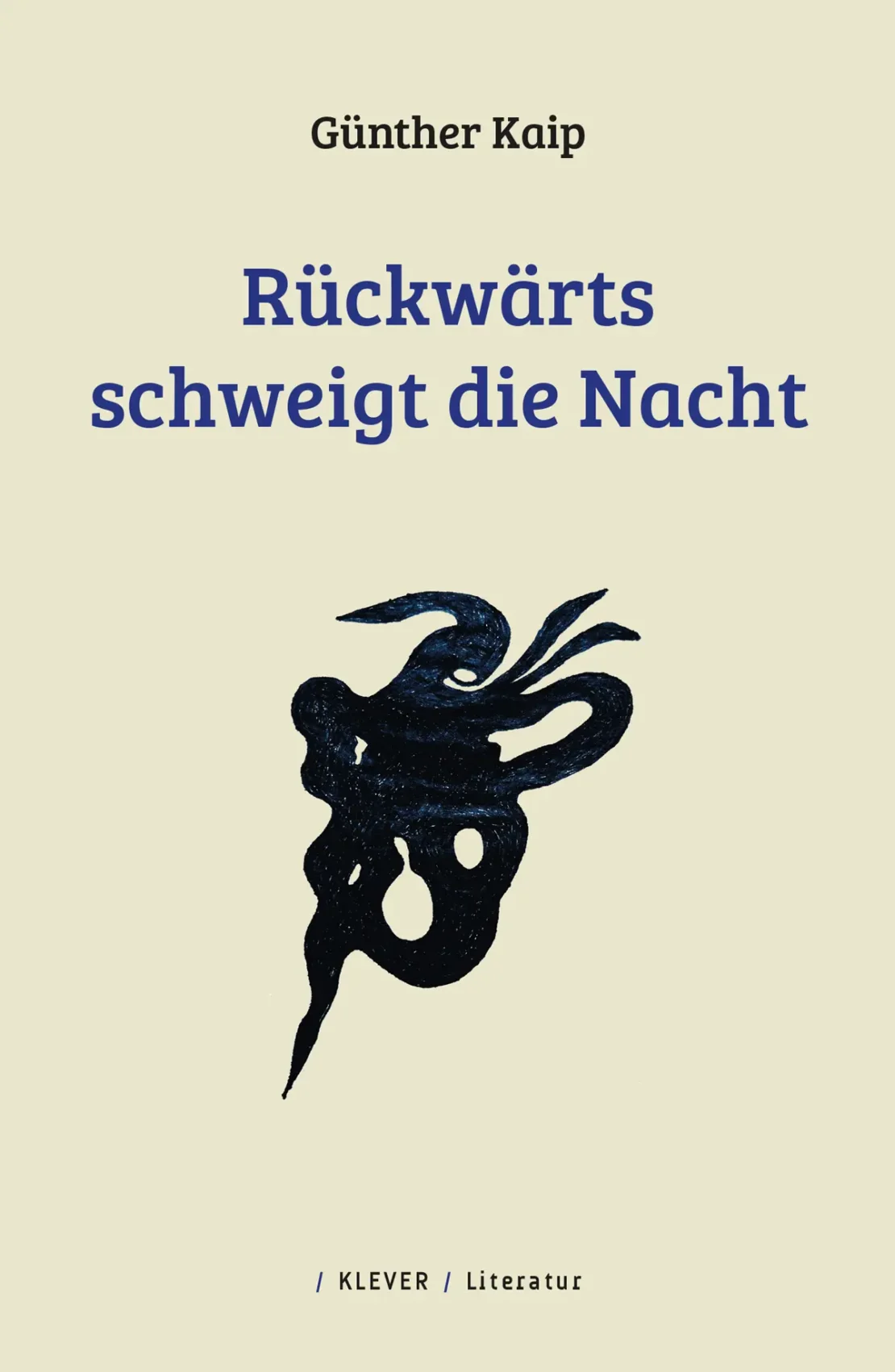Vergessen, surreal erinnert
Günther Kaip verdichtet Lyrik, Prosa und Zeichnungen zu einem traumhaften Ganzen.
„Rückwärts schweigt die Nacht“ – der Titel verräumlicht gewissermaßen, was beim Vergessen mit der gelebten Zeit geschieht. Passenderweise beginnt das Buch mit einem Aufruf der Unvollkommenheit von Erinnerung –
Das Gedächtnis ist nicht sehr vertrauenerweckend,
wälzt sich von einer Seite auf die andere […]
und endet mit einem floralen Stillleben:
Rückwärts schweigt die Nacht / verankert Blüten
in der Erde / aus denen Stille strömt.
Dazwischen: ungefähr ein Dialog, zwischen Ich (Normalsatz) und Ich (kursiv), die ungefähr ein Paar sind, alternd; ungefähr über die Drohung des Vergessens, Verlöschens, Verschwindens, von einem Alltag ungefähr umgeben, der seine Rhythmen entfaltet, alles in einer – wie mit dem Wort „ungefähr“ gesagt – artifiziellen und poetischen Sprache. Wir können uns die Situation in etwa wie einen Kunstfilm vorstellen, mit multiplen Voiceovers über das Altern oder das langsame Verschwimmen ineinander.
In diesen poetischen Verlauf eingebettet sind Prosagedichte, plus/minus eine Seite lang, welche die bereits im Dialog verhandelten Themen in symbolgeladenen Traum-Szenarien neu wiederholen bzw. variieren. Traumarbeit angesichts des Vergessens also – und tatsächlich liegt die Vermutung nah, dass diese Stellen der Entstehungskern des Bandes sind; Kaips authentisch-eigene Traumprotokolle oder zumindest solche Traumprotokolle, die Kaip für sein Textsubjekt in besonders glaubwürdiger Weise zu fingieren wusste. Im Licht dieser Leseweise erscheint der Rest des Bandes, jener poetisch verknappte oder verfremdete Dialog, als ein Prozess der Bewusstmachung, der lebenspraktischen Konkretisierung des vormals bloß Symbolischen.
Manche einzelnen Begriffe, die Kaip in diesen Zusammenhängen notwendigerweise verwendet, tragen – wofür der Autor nichts kann – die Abnutzung durch PR-, Werbe-, Managementsprache zur Schau; Wörter wie „Klangraum“ oder „Glücksmomente“. Diese Stellen fallen dann ein wenig aus dem Rahmen der als gänzlich intim gelesenen inneren Monologe, erscheinen angreifbar, als, anderswo, inszenier- oder manipulierbar. Aber das geht vorbei – und was ein „Glücksmoment“ ist, muss auch hier ein „Glücksmoment“ heißen.
Programmatisches:
Den Schlafenden Ohren aus Pappkarton ansetzen, damit sie ihre Traumgesänge besser hören. Nach dem Erwachen dürfen sie die grüngestrichenen Holztöpfe mit Erde füllen, etwas Alkohol beimengen und die am Nachtkästchen liegenden Kieselsteine tief in die Erde drücken, sie täglich mit Wasser gießen, ihnen gut zureden und sie in die Sonne stellen, bis zarte Kristalle aus der Erde wachsen.
An Stellen wie dieser, recht weit hinten im Verlauf, wird besonders greifbar, dass wir es im Wesentlichen mit dem Programm des Surrealismus zu tun haben, in einer x-ten Ableitung zwar, die deshalb freilich keineswegs steril wäre. Will sagen: Modi des Sprechens und Wahrnehmens, die wir mit der psychedelischen Kultur der Neunzehnsiebziger verbinden, angewandt jedoch auf die greifbare Lebenswelt eines alternden Paares in den Zweitausendzehnern, -zwanzigern. Dazu gehört, sowohl in dieser Zusammenschau als auch schon als Teil des Pakets surrealistischer Selbstverständlichkeiten, ein Beharren auf Geschichtslosigkeit, auf der prinzipiellen Abschaffung der linearen Zeit: Erinnerungssplitter, Traumsymbole, Wirklichkeiten im Hier und Jetzt – sie stehen gleichberechtigt nebeneinander, gleichberechtigt gerade weil bzw. genau in demjenigen Ausmaß, in dem der Gesamtzusammenhang der Erinnerung ungreifbar, unverstehbar wird. Anders
gesagt:
Rückwärts schweigt die Nacht.
Sie können das Buch hier erwerben.