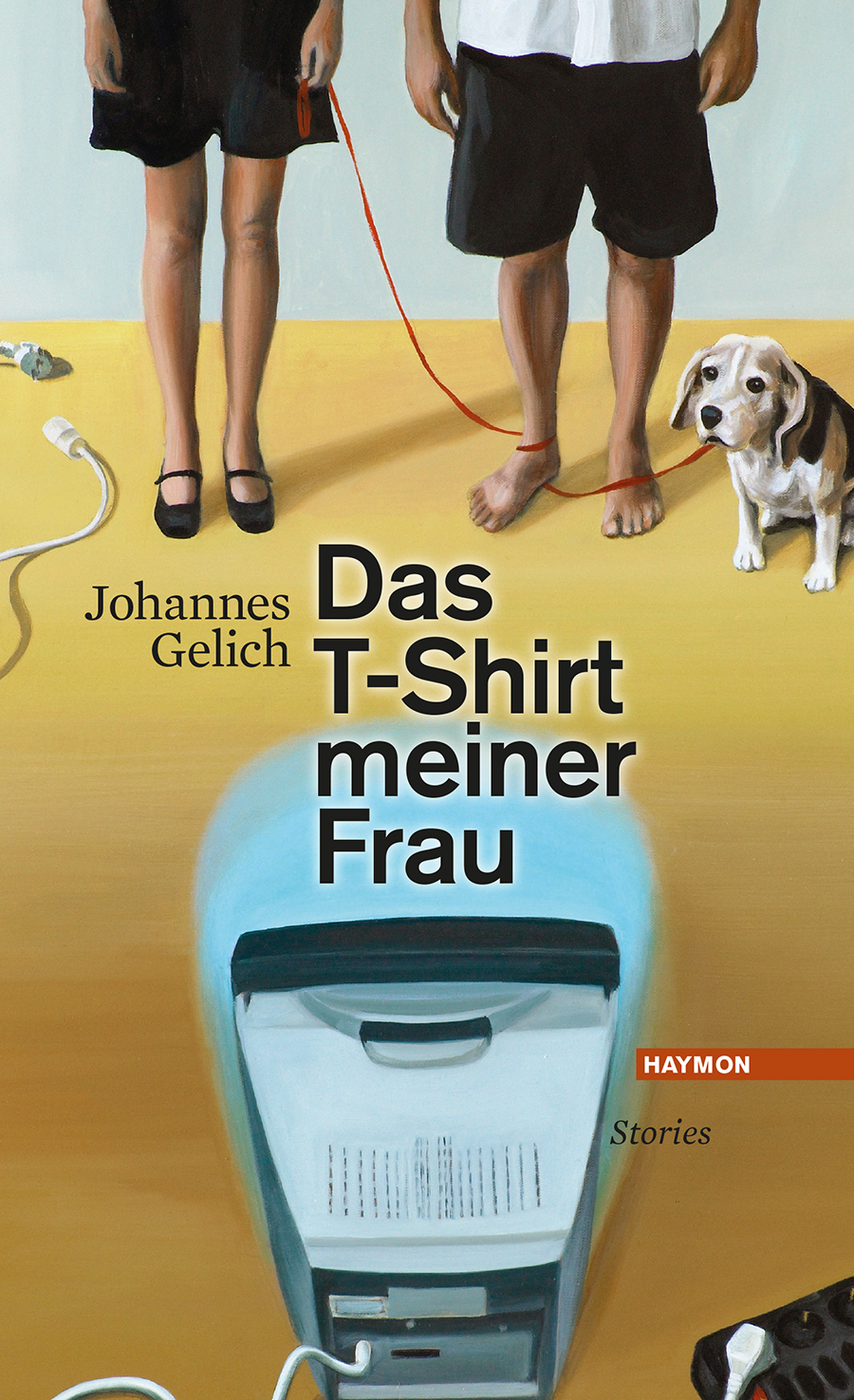Eisbergstorys
Johannes Gelichs Kurzgeschichten wirken als Text und Subtext gleichermaßen
Gemäß dem von Ernest Hemingway entwickelten Eisbergmodell sollte eine gute Kurzgeschichte wie ein Eisberg nur 8 % ihrer Masse an der Oberfläche zeigen, die restlichen 92 % aber darunter als Subtext wirken. Wenn der Autor weiß, wie sein Eisberg unterhalb der Wasserlinie des Ausgesprochenen aussieht, kann die tiefere Bedeutung der Geschichte implizit hindurchscheinen. In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt es nicht mehr viele, die das Eisbergmodell anwenden, umso erfreulicher ist es, wenn es jemand so meisterhaft tut wie Johannes Gelich in seinen „Stories“ und damit beweist, dass die Kurzgeschichte weit mehr ist als der Text eines Romanciers, dem der Atem ausgegangen ist.
Ein Paar fährt auf einem Schiff „von der Donaumündung in den Sulina-Kanal“. Während Eva schläft, überlegt Jeck, „ob er es ihr später sagen solle.“ Was, erfahren wir nicht. Will er sich trennen? Auf einer Reise? In Sulina buchen sie eine Kanutour ins Donaudelta bei einem Rumänen, der sich James nennt. Hier in der Wildnis, zwischen Pelikanen, Fröschen und Schlingpflanzen schaukelt sich aus dem Nichts ein Streit auf, der in dem Satz gipfelt, der auch den Titel der Geschichte bildet: „Ich will nicht nett sein!“ Und wieder überlegt Jeck, „ob er es ihr jetzt sagen sollte, (…) wie um das frische Ölgemälde, das sie gerade im Begriff waren zu malen, mit einem Kratzer zu verunstalten“. Ein „Kratzer“ klingt nicht nach einer Trennung, also was könnte es sein? Es ist der übercharmante James, der Jeck schließlich zur Weißglut treibt. Er stürzt sich auf ihn und bringt dabei das Boot zum Kentern. „Als er wieder an die Oberfläche gelangte, erblickte er ihre Köpfe, die aus dem von Seerosen bedeckten Wasser wie die Köpfchen von unbekannten Tieren ragten.“ James und Eva schauen Jeck verdattert an, als würden sie darauf warten, „dass er etwas sagen würde, wenigstens irgendetwas sagen würde“. Das Unausgesprochene wirkt – schöner hätte man die Eisbergtheorie kaum demonstrieren können.
Während die einen zu wenig sagen, reden die anderen zu viel. In Potty textet Herr Gilbert gnadenlos eine Immobilienmaklerin mit der Geschichte vom Töpfchengehen seines kleinen Sohnes zu, während diese gerade isst. Die Schilderung des Kinderklo-Ungetüms „Potty“, das beim Einfallen jeden Würstchens eine Fanfare ausstößt und den gequälten Vater im Wohnzimmer beim Fernsehen stört, gehört zu den komödiantischen Highlights des Buches. Doch auch hier schimmert durch, dass „Potty“ möglicherweise nur das Symbol für etwas anderes ist, das im Argen liegt, und dass Herr Gilbert nicht nur auf der Suche nach einer neuen Wohnung sein könnte.
Wohnungen sind oft der Schauplatz, und man darf sie getrost auch als Metapher für das Ich ansehen: jenen Ort, an dem man grundsätzlich alleine ist, an den Stimmen und Geräusche dringen, die nicht immer einzuordnen sind, und durch dessen Fenster-Augen einen auch ein herabstürzender Schatten streifen kann, der auf eine Tragödie in einer anderen Wohnung hinweist. Die Geschichten werden gerne über die Bande gespielt: Es wird erzählt, wie jemandem etwas erzählt wird, oder gar, wie dieser es wiederum weitererzählt. Durch diesen Kunstgriff wird einerseits die nötige Distanz eingezogen, um auch politisch Inkorrektes im Licht der Ironie erscheinen zu lassen, und andererseits das Wirken von Geschichten als Meme vorgeführt. Es geht um die Tücken der Kommunikation, etwa wenn einer eine E-Mail von einer Magda bekommt, aber gleich zwei Verflossene dieses Namens unangenehm in Erinnerung hat; wenn ein anderer versucht, seinen Chef durch Fachwissen in der Schmetterlingskunde, dessen Steckenpferd, zu beeindrucken, und dabei den Karren wortreich gegen die Wand fährt; oder wenn ein Dritter die Gelegenheit, der hübschen Nachbarin näherzukommen, tatenlos verstreichen lässt, um am Ende mit dem Bild eines nackten Mädchens auf seinem Monitor allein zu bleiben. Dann wieder gibt es unerwartetes Gelingen: In Was ist denn? versucht ein Vater seinem pubertierenden Sohn näherzukommen, indem er ihm Dinge erzählt, die wohl jeden Jugendlichen vor Peinlichkeit sterben lassen würden – und doch gelingt es ihm, dem Jungen einen einzigen Satz herauszulocken, der zeigt, dass eine Annäherung stattgefunden hat.
Gelichs Storys sind vielschichtig, unterhaltsam, sorgfältig konstruiert und in einer präzisen Sprache gehalten, die ohne großen Bombast auskommt. Und sie können das, was gute Literatur manchmal kann: In der Ich-Wohnung des Lesers das eine oder andere Fenster öffnen, das bis dahin unbemerkt war.