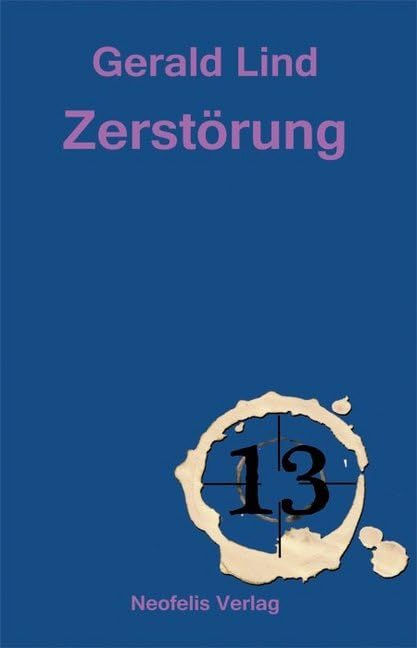Der Lind, der lacht
Ein Autor im Spiegelkabinett des Dekonstruktivismus
Gerald Linds Buch Zerstörung besteht, neben Einsprengseln, aus einer Sammlung fiktiver Sekundärmaterialien zu einem Buch namens Zerstörung eines fiktiven Autors Gerald Lind. Dieses Buch hat, wie das real vorliegende, zum wesentlichen Gegenstand die Selbstverortung des fiktiven Autors in der Tradition von David Foster Wallace, dann das kalkuliert Pampige, Gerngroße, Fadenscheinige dieser Selbstverortung, schließlich ihre bruchlose Übernahme durch Literaturkritik und -wissenschaft. Der reale Text verweist auf sich selbst als Teil eines infiniten-Regresses aus Literaturbetriebsjargon, Feuilleton-Statusspielchen, Autoritätsanrufungen.
Zerstörung lässt sich mit einem bekannteren Beispiel für einen infiniten Regress vergleichen: mit dem Logo der französischen Schmelzkäsesorte „La vache qui rit“: eine lachende Kuh, welche das Logo als Ohrring trägt, das in einer lachenden Kuh besteht, welche das Logo als Ohrring trägt, das usw. usf. Im Fall der Schmelzkäsereklame kommt der dargestellten Kuh noch so etwas wie ein Primat des Dargestellten zu, mit dem Loop bloß außen drum herum. Zerstörung dagegen stellt von vornherein nichts dar als sich, den Loop, selbst. Auf der ersten Doppelseite finden wir, nach Art amerikanischer Bestseller, unter der Überschrift „Praise for Zerstörung“, „Zitate“ aus Tageszeitungen (”Eine Abrechnung, ein Wink mit dem Zaunpfahl, eine Zerstörung. Philadelphia City Paper“ u. Ä.). Hier können wir noch daran glauben, es handle sich um einen vereinzelten Witz, der sich im Lauf des noch kommenden literarischen Textes erklären werde. Wenn dann aber auf der nächsten Doppelseite das „Titelblatt“ folgendermaßen lautet – „Zerstörung13 von Gerald Lind (Autor von Zerstörung). Aus dem amerikanischen Englisch von Gerald Lind14“ – wobei in den Fußnoten steht: „13). Der Titel des Buches ist entnommen: Duden. Die deutsche Rechtschreibung. […]“ und „14) Titel der 2011 erschienenen Originalausgabe: Destructionisms“ – und links gegenüber der Hinweis prangt „Außerdem ist von Gerald Lind erhältlich: Personenregister zu Gerald Linds Zerstörung“, dann wissen wir ungefähr, wohin der Hase läuft bzw. in welche Richtung diese Zwiebel geschält werden will.
Lind dekliniert auf den darauf folgenden ca. 160 Seiten alle Möglichkeiten durch, Paradoxa von Selbstsetzung, Selbstreferenz und auch Selbstwiderspruch in einen Text einzubauen; gleichzeitig – an den Stellen des Buches, da nicht „Literaturwissenschaftler“ und „Kritiker“ sprechen oder Zitatlisten prangen, sondern die von „Gerald Lind“ stammen – post er als Poser, der posend die Kritik an seinem Gepose zurückweist. Auch dies ein Loop; ein Hin und Her zwischen pubertärer Subjektivität und nur scheinbar reiferer Abstraktion.
Eingangs schrieb ich, Linds Buch bestehe „neben Einsprengseln“ aus so gearteten Loops und Spielchen. Was meine ich nun mit „Einsprengsel“? – Das (gleichwohl streng durchgezogene) Konzept erlaubt das Ausfasern des Texts in alle möglichen Richtungen, das „Aufhängen“ ganz unterschiedlicher Textsorten und Inhalte in diesem Rahmen. Natürlich stehen diese Textsorten und Inhalte dann jeweils unter mehreren Anführungszeichen, werden als Zitationsmaterial weiterverwendet usw. Ihnen gemeinsam ist, dass in ihnen inszeniert wird, wie dem fiktionalen Autor Lind oder einem der zahlreichen „Literaturkritiker“ die Maske der literaturbetrieblichen Souveränität verrutscht und ein banales, leicht angreifbar blödes „Eigentliches“ zum Vorschein kommt.
Ich habe mich deshalb im Laufe meiner Lektüre von Zerstörung dazu entschieden, das Buch zunächst als Literaturbetriebs- und Literaturwissenschafts-Satire zu lesen. Die Genauigkeit, mit der Lind die Tonfälle der schnell-schnell zusammengeschusterten Sem nararbeit, des Leitartikels, des Klappentexts, der selbstgeschriebenen Autorenvita, des eitlen Essays, des Netzwerker-Briefchens und dergleichen mehr trifft, ist bemerkenswert. Handwerklich dahinter zurückbleiben leider die Dramolette und inszenierten mündlichen Dialoge, die immer wieder mal vorkommen: Auch sie laufen punktgenau auf ihre jeweiligen Pointen hinaus und stören nicht den Lesefluss, wirken aber in ihren Details oft unnatürlich und, selbst innerhalb ihres so ausgesprochen konstruierten Bezugssystems, unangenehm überkonstruiert. Anders gesagt: Wo Lind und „Lind“ schriftliche Sprachverwendungsweisen parodieren, funktioniert die Parodie, weil Leute tatsächlich genau so schreiben und sich in genau der inszenierten Weise ihre Blößen geben; wo Lind und „Lind“ dies mit mündlicher Sprache tun, treffen sie nicht in derselben Weise die sprachliche Wirklichkeit außerhalb von Zerstörung. Zumindest nicht ganz.
Die zugrundeliegende Idee von Zerstörung ist nicht neu; viele der Kunststücke, die Lind und „Lind“ ihr Material machen lassen, würden mich bei bloß vereinzeltem Vorkommen abwinken und müde schmunzeln lassen. Da aber ein ganzes Buch auf ihnen beruht, machen sie mir überraschenderweise Spaß. Dies auch, weil Zerstörung als – ausgesprochen böser – Kommentar zum Zustand der professionellen Literaturrezeption einiges für sich hat.
Um zum Schluss „Lind“ mit einem Zitat aus „Addendum III. Hauptrede“ von Zerstörung zu Wort kommen zu lassen: „Auch Gerald Linds Roman Zerstörung dokumentiert die Erfindung eines (mit 34 Jahren nicht mehr wirklich) jungen Schriftstellers über Spiegelungsmodi, ganz unabhängig davon, ob man von einem fiktionalen oder einem re len Autor ausgeht.95“ Nun Fußnote 95: „Diese Unterscheidung ist für den hier zu diskutierenden Sachverhalt letztlich unerheblich, wiewohl festgestellt werden kann, dass Lind sich insofern als Anti-Pessoa geriert, als Fernando Pessoa für einen Autor zwanzig Namen hatte, während Lind für zwanzig Figuren nur einen, nämlich seinen, Namen hat.“ Na dann.