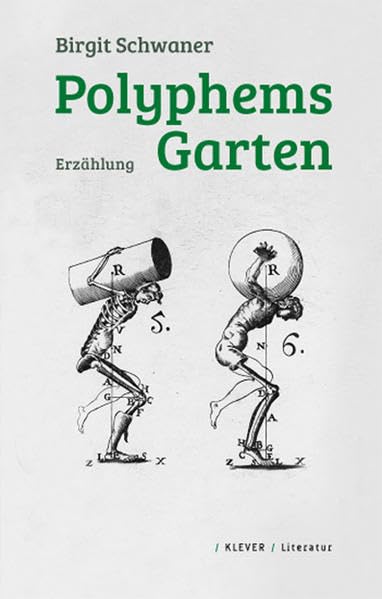Verharren vor dem Wysiwyg
In Polyphems Reich soll die Welt des Buches ausgelöscht werden
Seltsam verstörend trifft die Künstlichkeit der Welt, von der in Polyphems Garten erzählt wird und die doch so negativ dargestellt ist, auf die fröhliche Künstlichkeit der Erzählung, als sei sie darin irgendwie angelegt – angesichts dessen, dass hier das Regime des Polyphem die Welt des Buches auslöschen will, ein bedrohlicher Gedanke. Das „Poein“, das „Machen“ der Dichtung, scheint mit dem Erzeugen, das die Welt dieser Polyphem Corporation so sehr beherrscht, verwandt (ein schönes Symbol, dass die geheime Bibliothek des Polyphem gerade unterhalb seines Herrschaftsbereichs liegt, jenen sozusagen fundiert). Und umso deutlicher wird diese doppelte Besetzung des Herstellens, wenn im beschriebenen Polyphem’schen Reich die Waren gerade wie früher die Texte ausgedruckt werden. An die Stelle aber des nunmehr verbotenen Lesens ist das stundenlange Verharren vor dem „Wysiwyg“ getreten, mit dem die so genannten „Meisten“ zum Konsumieren, zum Ordern von Waren gebracht werden. Ein Zeitalter der Mündlichkeit, das man vor langer Zeit verlassen, ist wiedererschaffen, ein Zeitalter ohne Geschichte, ein Leben aber auch unter totaler Beobachtung. Wir erkennen unschwer eine überspitzte Beschreibung gegenwärtiger Entwicklungen in der Darstellung des Polyphem’schen Überwachungsstaates. Ja, Schwaner wendet hier einen interessant distanzierenden Trick an, indem sie, was wir eigentlich schon kennen, als Zukunft inszeniert und so die Ungeheuerlichkeit der Gegenwart erst sichtbar macht. Sie erzählt von spionierenden Drohnen, Mauern zwischen Arm und Reich, implantierten Chips und Tieren, die infolge von chemischen Unfällen ausgestorben sind. Und sie setzt diese real existierenden Versatzstücke der Dystopie wieder in Bezug zum Machen, gerade indem sie sie als „Nur-Geschichte“ darstellt, als durch Erfindung erzeugte, als Poesie. Überhaupt kommt dem Machen über das Schreiben und kreierende Lesen in Polyphems Reich ganz revolutionäre Bedeutung zu: „Alles neu, weil alles vergessen“, heißt es gegen Ende des Texts. Es ist das Erinnern, das mit den Kulturtechniken der Schrift und des Lesens verloren gegangen ist. Hier aber liegt auch die Achillesferse des Systems – es ist eben auch das Erinnern, das Wissen, ergo die Bibliothek, die der Macht gefährlich werden kann. Soeben hat der Ingenieur Ping noch für Polyphem „Kreatorköpfe“ produziert.
Sie sollen Kunst hervorbringen und den Despoten Polyphem – so versteht jener die Sache – zum Künstler machen. Doch Ping und Nina, Vorleserin aus der Zeit des Übergangs zur totalen Mündlichkeit, sind bereits dabei, in die unterirdische Bibliothek, die sich Polyphem eingerichtet hat, einzubrechen, um die Menschheit mithilfe von Büchern, mithilfe von Wissen, wachzurütteln. Man will die „Wysiwigs“ kapern, um die alten Autoren und Autorinnen über dieses Medium bekannt zu machen, um der Welt ihre Reflexionsfähigkeit und damit ihre Handlungsfähigkeit wiederzugeben. Noch einmal kehrt der Text zurück zur Reflexion des „Poein“, des Machens. Er hat diese Welt der Polyphem Corporation produziert, ihre Gesetze und Gegenstände – gewissermaßen die Wörter und die Grammatik einer Zukunft – bereitgestellt. Nun muss es ans Handeln, an die Handlung des Buches gehen. Ab hier müssen Sie selbst weiterlesen.