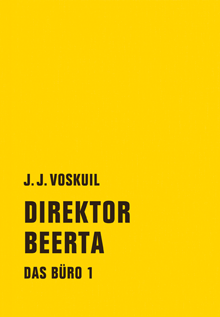Das Leben unter Anführungszeichen
J. J. Voskuil verhandelt verschiedenste Facetten von Entfremdung
Googelt man die Rezensionen und Veranstaltungshinweise zu J. J. Voskuil, stellt man fest, dass das Interesse für den niederländischen Autor (1926-2008) und für sein wichtigstes Werk, Das Büro, in Deutschland ungleich größer ist als in Österreich. Neben der ausführlichen Behandlung, die Voskuil in Deutschland in den letzten Jahren erfahren hat, nehmen sich die gerade mal zwei österreichischen Rezensionen von 2012, die ich fand, eher mickrig aus. Diese zwei übrigens (ORF.at und Kurier) verdankten sich der damals eben bei C. H. Beck erschienenen deutschen Übersetzung des ersten Bandes von Voskuils Romanzyklus – Das Büro, Band 1: Direktor Beerta.
Soweit es Beck betrifft, blieb es bei diesem ersten Band. Alle weiteren sind in der Zwischenzeit, weiterhin in der Übersetzung von Gerd Busse, sukzessive beim Verbrecherverlag erschienen, mit den beiden letzen – Band 6: Abgang und Band 7: Der Tod des Maarten Koning – aktuell in Vorbereitung. Wenn Verbrecher nun also jenen ersten Band in eigener Auflage neu herausgebracht hat, dann ist das gerade noch früh genug, um die über 800 Seiten des Wälzers zu absorbieren, ehe die letzten Bände der Reihe erscheinen (und für die, denen so etwas wichtig ist, die Gelegenheit, ein einheitliches Erscheinungsbild der ganzen Serie im Regal zu erzielen).
Was ist also Das Büro? – Wenn wir so etwas sagen wie „Die mehrere Tausend Seiten lange Chronik eines gelangweilten Dahinlebens“, werden wir dem Phänomen nicht gerecht. Zwar liegt eine solche Chronik vor, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die epische Breite, die Voskuil entfaltet, die Vielzahl seiner Figuren und der Realismus seiner Darstellung – und zwar: alles dies just angesichts eines so unspektakulären Gegenstandes wie des Alltags an dem Volkskundeinstitut, an dem Voskuils Held und Alter Ego Maarten Koning 1957 wenig motiviert zu arbeiten beginnt, im Laufe der Jahrzehnte.
Es geht in der ganzen Buchreihe um Entfremdung, wie sie selbst noch in so scheinbar komfortablen und intellektuell anregenden Arbeitszusammenhängen wie jenen im Uni-Umfeld greift, um die ständige innere Distanz eines permanenten „Lebens unter Anführungszeichen“. Natürlich hat dieses Thema auch eine konkret-politische Seite – das gesellschaftliche Klima, in dem Voskuils Figuren gedeihen, ist geprägt einerseits von Anzeichen sozialdemokratischer Hegemonie, sozialliberaler Alltagskultur in den Institutionen, andererseits aber von dem so völligen Ausbleiben der Ziele der Sozialdemokratie und des sozialliberalen Gestus, sagen wir: das Scheitern aller Hoffnungen auf das „erfüllte Leben“ „ganzer Menschen“, ermöglicht durch Wohlfahrtsstaat, Sicherheit und die (illusionäre) Abwesenheit systemischer Korruption. Zwischen der detaillierten und ungeschönten Schilderung eines partikularen Systems einerseits und andererseits der unverstellten Erkennbarkeit dessen, was an diesem Partikularen typisch oder typologisch sein soll, können wir in Voskuil einen solitären Ausläufer jenes literarischen Realismus erblicken, den wir besser nicht den „sozialistischen“ nennen sollten, wenn wir keine Leser verschrecken wollen …
… und das klingt nun alles viel weniger unterhaltsam, als die Bücher tatsächlich sind. Nicht umsonst haben sie in Voskuils Heimat einen wahren Boom ausgelöst, mit ausverkauften Auflagen, einer schier endlosen Hörspielreihe („Seifenoper für Intellektuelle“, schrieb die Kritik) und z. B. Stadtführungen auf Maartens Spuren. Als Referenzgröße zu diesem Phänomen mag dem gelernten Österreicher Edmund „Mundl“ Sackbauer dienen …
… und als Einstieg in den Kosmos Voskuil (beziehungsweise als Entscheidungshilfe, ob man sich denn weiter drauf einlassen möchte) dieser neu aufgelegte erste Band von Das Büro.