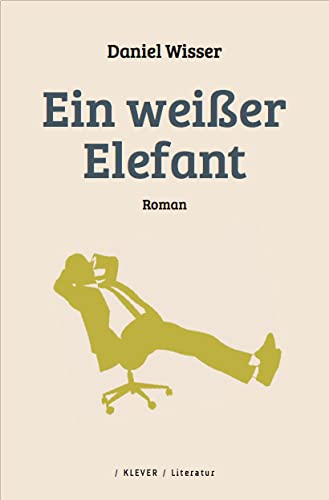Im Ausgedinge
Daniel Wisser widmet sich in seinem neuesten Werk ganz besonderen geschützten Arbeitsplätzen
Es scheint, als ob Daniel Wisser an einer Bestandsaufnahme der modernen Arbeitswelt arbeitet. Nach seinem Roman Standby aus dem Jahr 2011, der sich „der Künstlichkeit unseres Alltags, der Alltagsabläufe, der Berufsabläufe, der Abläufe in einem Büro“ (Franz Schuh am Umschlagtext des Buches) annahm und dessen in einem Call Center tätiger Protagonist unter klassischer Entfremdung leidet und dennoch unter Groll und mit ständig wachsendem Vorbehalt immer weiter und immer weiter macht, obschon ein wütender Ausbruch nahe zu liegen scheint. Und der, so legt es der Titel nahe, auch ein sehr passiver, so genannter „Schläfer“ sein könnte – wehe wenn er losgelassen!
In Ein weißer Elefant geht es nun um zwei arbeitslose Arbeitende, die der Musiker (Erstes Wiener Heimorgelorchester), exzellente Textvortragende (unter anderem das Programm Ich zünde nachts Italien an) und Autor Daniel Wisser ins Rampenlicht rückt. Weiße Elefanten werden Menschen genannt, denen ihr Arbeitsfeld entzogen wird, die ausrangiert, aber nicht entlassen oder gekündigt werden. Untätig sitzen sie in ihren Zimmern, bar jeder Aufgabe. Zwei solcher Menschen treffen in Wissers neuem Roman aufeinander. Einer der beiden ist ehemaliger Leiter der IT-Abteilung, hat ein Verhältnis mit drei Frauen, die nichts voneinander wissen, muss für Alimentationszahlungen aufkommen und war in einer maßgeblichen Position in jenem Unternehmen tätig, das ihn nunmehr ins Ausgedinge abgeschoben hat. Hier wird viel vom Bild des weißen, männlichen, karriereorientierten Mannes kapitalistischer Prägung in Szene gesetzt.
Ironischerweise war es gerade dieser Mann, der in seiner ehemaligen Funktion ein Konzept für mehr Effektivität und Effizienz erarbeiten musste, das, wie könnte es anders sein, auch Personalabbau vorgesehen hat. Nun sitzt er in einem kahlen Arbeitsraum vor einem Computer ohne Internetzugang, ohne Aufgabe, aber mit der Verpflichtung, die Arbeitszeiten einzuhalten, ansonsten: Kündigungsgrund. Ein Opfer seines eigenen Maßnahmenplans. In diesem Mikrokosmos spiegelt sich die Absurdität eines auf sich selbst konzentrierten kapitalistischen Systems wider, das keine ethischen Werte mehr kennt. Das Gemeinwohl wurde in den 80ern abgebaut, Personalressourcen sind verschiebbare Massen. Im Duett mit dem zweiten weißen Elefanten, der kryptisch im Hintergrund bleibt und an dessen Existenz man als Leser zwischendurch auch Zweifel hegen möchte, spielen sich sodann in der kleinen Welt des abseits gelegenen Kämmerleins all jene Szenen ab, die auch in der großen Welt des Arbeitsmarktes präsent sind: Forderungen vom (ehemals) hierarchisch höher Stehenden an den (ehemals) niedriger Positionierten, Fragen der Leadership und Dominanz werden aufgeworfen, naiv-karriereorientierte Schritte des ehemaligen Leiters, der sich nicht in die Situation einfügen will, werden angerissen, wohingegen der andere sich zurückzieht und fügt. Für ihn scheint es kein Warum zu geben, kein Weil, es gibt nur das Tun oder Nichtstun um seiner selbst willen. Es ist die Entlarvung der Arbeit als lediglich eine von zahlreichen Möglichkeiten, sein Leben sinnvoll zu gestalten, denn die Arbeit als heilige Kuh, als vermeintlich einzig sinnstiftende Aktivität im Menschenleben läuft hier völlig ins Leere.
Wisser lässt sein Personal monologisieren wie weiland Thomas Bernhard, er lässt sie anprangern und gleichzeitig mitspielen, er lässt sie auflaufen und aufbegehren, dennoch bleiben sie machtlos. Alles, was einem der beiden weißen Elefanten bleibt, ist seine sinnlose Statistik über die Anzahl der Autos, die an der aus dem Fenster zu beobachtenden Kreuzung in alle Himmelsrichtungen abbiegen können. Eine Option, die den weißen Elefanten längst schon genommen wurde. Ein weißer Elefant ist eine bestechende Allegorie auf das moderne Arbeitsleben und noch präziser und schonungsloser formuliert, als es Standby bereits war.