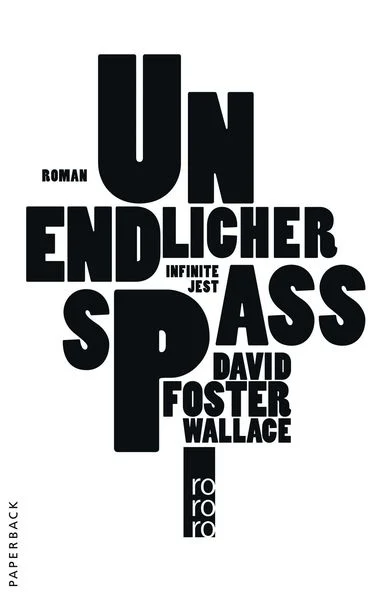Das Buch vom Spaß – ein unendlicher Wälzer
oder Viele kleine Katastrophen ergeben eine große.
1
Um es kurz und gleich zu Anfang zu sagen: Der Roman Unendlicher Spaß von David Foster Wallace führt uns in die dunklen Kammern des Innenlebens der USA. Das Land ist süchtig, könnte man sagen, wenn man dieses Buch liest. Wenn ich die vielen Protagonisten beobachte, kommt es mir vor, als sei dieses große Land auf der Flucht, auf der Flucht vor sich selbst. Mir werden hier alle Stufen der Sucht vorgeführt, bis hin zum Entzug. Aber ein gelungener Entzug, eine gelungene Therapie nützen nicht, wenn man hinterher wieder auf dieselbe Sucht veranlassende Wirklichkeit trifft. – Gibt es also das Konstruktive, die Gegenbewegung in dem Buch von David Foster Wallace überhaupt nicht? Doch, sie existieren. Nämlich allein schon insofern, als da einer ist, der den Verfall dokumentiert, festhält, objektiviert. Doch ehe wir uns eine einzelne Situation in diesem Buch genauer ansehen, kommen wir noch einmal auf den großen, fliehenden Staat zurück. Dieses ist das modernste Land der Welt. Dieses ist der mächtigste Staat, der überallhin, in alle Ecken und Gegenden des Erdballs, ausstrahlt. Wie also soll es in anderen Ländern zugehen, wenn das Innenleben des Mächtigen, Großen schon so zerfressen aussieht?
2
Ich selbst habe das Innenleben Berlins kennengelernt, während die Fiktion des Autors das Innenleben eines großen Staates vorstellt. Beide Innenleben siedeln an ganz verschiedenen Punkten einer Skala. Während uns der Autor vor allem und immer wieder Männer, jung oder „in den besten Jahren“, vorführt, die der Sucht verfallen, die sich der eigenen Freiheit begeben, lernte ich in Berlin während siebeneinhalb Jahren, die längst zurückliegen, vor allem Frauen kennen als Teil des Innenlebens der großen, oft arm schillernden Stadt. Nicht selten waren sie zwischen neunzig und bis zu einhundertacht Jahren, und ich besuchte sie als Krankenpfleger in ihren Wohnungen. Teils sehr große Wohnungen, teils sehr beeindruckende Wohnungen, deren Mobiliar, deren Bilder an den Wänden auf vergangene, auf gelebte Zeiten hinwiesen. Die Frauen lebten zumeist allein, und nicht wenige von ihnen konnten aufgrund ihrer Hinfälligkeit ihr so zum Gefängnis gewordenes Zuhause nicht mehr verlassen. David Foster Wallaces Männer befinden sich im Gefängnis der Sucht. Haben sie sich freiwillig hineinbegeben? Es so zu formulieren, wäre viel zu anmaßend. Und dass es so viele abhängige Männer sind, verweist eher auf eine Epidemie der Gesellschaft oder auf ein Epidemie-Ähnliches. Und eher verweist es auf ein Scheitern der Gesellschaft als auf ein den Männern eigenes Scheitern. Auch die alten Frauen in den Wohnungen Berlins scheitern bitter, gleich welche Strategie sie auch anwenden, der Einsamkeit des Alters zu entfliehen. Genauer gesagt, scheitert die Gesellschaft in jedem einzelnen Fall, als hätte sie, so wie sie ist, nichts anderes anzubieten, als diesen Menschen als Lebensalternative zumeist nur das Dahindämmern in Räumen zu versprechen, in denen sie schon immer lebten.
3
Aber ja, es existieren so viele Stellen in dem Buch, die nicht nur durch Humor, Satire und Zynismus zu glänzen vermögen, sondern darüber hinaus den Leser mit positiven Gefühlen zurücklassen. Es sind da die drei Brüder, Orin, der älteste, Hal und Mario Incandenza, Letzterer der jüngste, die im Zentrum des Romans stehen, welche gemeinsam die in alle Richtungen ausfransenden Erzählfäden zusammenhalten. Oder doch die in einige Richtungen ausfransenden Erzählfäden. Alle drei Brüder fallen durch besondere psychische (sagen wir: seelische) Eigenarten auf. Und es ist eine berührende, zugleich urkomische Szene, in der das Miteinander des Deutschen Gerhardt Schtitt mit Mario Incandenza vorgestellt wird. Schtitt ist
Cheftrainer und sportlicher Direktor der Enfield Tennis Academy in Enfield, Massachusetts … auf die siebzig zugehend … Wenn er also den ledernen Kopfschutz und die Brille aufsetzt, die alte BMW, noch aus BRD-Tagen, aufjaulen lässt und hinter den schwitzenden E. T. A.-Kadern her bei ihren nachmittäglichen Konditionsläufen die hügelige Comm. Ave. nach East Newton hochjuckelt und wohlüberlegt sein Blasrohr zum Einsatz bringt, um zurückfallenden Faulpelzen Dampf zu machen, darf für gewöhnlich der achtzehnjährige Mario Incandenza, sorgfältig gestützt und angeschnallt, im Beiwagen mitfahren; der Wind lässt seine dünnen Haare hinter seinem überdimensionierten Kopf herflattern.
Mario Incandenza ist gehandicapt, so sehr, „dass er nicht mal einen Stock festhalten kann.“ Jedoch nicht nur körperlich. Aber Schtitt und er haben sich angefreundet, und der fast Siebzigjährige öffnet sich dem Achtzehnjährigen. David Foster Wallace stellt uns den Dialog zwischen den beiden vor, und wer den Äußerungen Schtitts (oder seinen Gedanken und den Bewegungen seines Innenlebens) irgendwann nicht mehr ganz folgen kann, der kann trotzdem den Unterhaltungswert dieser Szene ganz ermessen. Denn der Jüngere spiegelt hier und da wenigstens emotional die schwieriger sich ausbreitende Theorie des alten Cheftrainers. – Marios, Hals und Orins Vater, Dr. Incandenza, hatte diese TennisakademieE.T.A.(einE.T.A.wiebeiE.T. A. Hoffmann!) gegründet. Er war es gewesen, der sich sehr frühzeitig um die Anstellung Schtitts in seiner Akademie bemüht hatte, denn Schtitt betrachtete das Tennis – wie Incandenza selbst – von einer ganz anderen Seite her als von der pur sportlichen, als von der pur langweiligtechnisch-praktischen. Der Kontrast zwischen einem sehr theoretisch denkenden Cheftrainer, den die meisten Jugendlichen an der Akademie „für vermutlich plemplem“ halten, und dem ihm mit köstlicher Einfalt – oder mit ebensolcher Begrenztheit – begegnenden Mario, also nicht nur zwischen einem Alten, Erfahrenen und einem äußerst naiven und zum Glück wohlbehüteten Jüngling, könnte größer nicht sein. Was aber hatte Dr. Incandenza und Schtitt lange vor Incandenzas Freitod miteinander verbunden?
Incandenza war so erpicht darauf, Schtitt an die E. T. A. zu bringen, weil dieser wie der Gründer selbst … dem Wettkampftennis eher mit dem Verstand des reinen Mathematikers als dem eines Technikers begegnete.
Schtitt selbst aber ist zwar nicht sehr bewandert in Mathematik. Dennoch hat er ähnliche Theorien zum Tennissport, wie ein Mathematiker in vergleichbarem Maße sie hätte. Er hat erkannt, Ich bekomme hier also lauter Reichtum an Ideen geboten sowie lauter Absonderlichkeiten, die jedoch häufig auf Tiefliegendes verweisen: einen Deutschen, „von Kindesbeinen an in festen Werten verankert … – die – ja okay, zugegeben – womöglich einen Deut protofaschistischen Potenzials haben, aber nichtsdestotrotz Seele und Lebenslauf festen Halt geben – alteuropäisches patriarchalisches Zeug wie Ehre, Disziplin und Loyalität einem größeren Gebilde gegenüber …“, einen Jüngling, dem es einfach in seinem So-Sein gegeben ist, das Vertrauen des Alten zu gewinnen, und der nicht nur zum Brüllen komische, sondern auch treffende Anmerkungen macht, die das Gespräch befördern; ich bekomme eine sehr ästhetisch und klug daherkommende Theorie zum Leistungssport, über den man ansonsten andernorts vergleichsweise nur lauter Plattheiten zu lesen und zu hören bekommt; ich lese über die anrührende Geschichte einer Zweierbeziehung, die tatsächlich beiden Beteiligten auf- und weiterhilft, sich als Mensch anerkannt zu fühlen, sich als Mensch weiterzuentwickeln, als Mensch gebraucht zu werden.
4
Passiert an der eben erwähnten Stelle eine Umwälzung in dem Roman? Eine Wende hin zum bloßen Mit-Fühlen, das zwar immer noch den Humormantel anbehält, aber darüber nicht mehr den dicken Mantel der Satire? Es ist so. Ein Handschuh wird hier umgestülpt. Wurde vorher mit dessen Hilfe alles
dass das Lokalisieren von Schönheit, Kunst, Magie, Vollendung … überhaupt keine Frage der Reduktion war, sondern … eine der Expansion, des … unkontrollierten, metastasierenden Wucherns – jeder gut geschlagene Ball erlaubte n mögliche Reaktionen, diese wiederum erlaubten 2-hoch-n mögliche Reaktionen undsoweiter … und schließlich ein Spiel schufen, diese Grenzen des Ichs.
spitzfingrig angefasst, mit dem Handschuhzeigefinger distanziert auf Szenen in einer Ferne gewiesen, so zeigt sich jetzt, dass der außen sehr glatte, sehr sterile Handschuh innen doch ein Wollhandschuh ist: Man muss ihn nur völlig umstülpen, um alles das zu erkennen. –
Eine andere Szene möchte ich vorstellen. Wiederum zeigt sich David Foster Wallace – er nahm sich wie sein im Roman bloß noch posthum genannter Protagonist Dr. Incandenza (der Vater der drei Brüder) das Leben – hier sehr menschlich, wiederum stellt ihn die Szene als menschlich teilnehmend vor. Text wie Autor rücken einem hier sehr nahe. Und das, obwohl – oder weil – doch alles zu Anfang nüchtern, fast dokumentarisch wiedergegeben wird. Wären da nicht die Gedanken und Gefühle des jungen Arztes – mit bislang noch kaum Psychiatrieerfahrung –, die ebenfalls, neben dem Dokumentarischen, wiedergegeben werden. Die Einundzwanzigjährige vor ihm, Kate Gompert, hat drei ernste: ernsthafte Selbstmordversuche hinter sich. „Der Arzt befand sich in einer Verfassung zwischen Angst und Erregung, was sich in Form einer sanften, tief verwirrten Besorgnis äußerte“, schreibt David Foster Wallace. Die Begegnung zwischen Arzt und Patientin beginnt zunächst mit, man würde sagen, herrlichstem (wäre die Situation nicht so ernst) Aneinandervorbeireden. Dann aber folgt der Leser einem hochspannenden Dialog, in dem alles eine Rolle zu spielen scheint, auch wenn der Arzt im Praktikum (der keinen Namen bekommt) noch lange nicht in der Lage ist, routinemäßig jedem Geräusch, jeder Bewegung eine konkrete medizinische: psychiatrische Bedeutung zuzumessen, oder wenigstens in der Lage ist, auf eine mehr oder weniger starke Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Bedeutung hin zu spekulieren. Ungeachtet dessen handelt es sich in der Erzählung an diesem Punkt um eine fachlich sehr hochstehende Beschreibung. („Das leichte Nicken des Arztes war nicht als Reaktion gemeint, sondern als Einladung fortzufahren, in Dretskes Terminologie war es ein Impulsierer.“) Dann bricht aus Kate Gombert heraus, warum sie sterben will, und da es sich um einen Roman, ein Kunstwerk, handelt, könnte sie vielleicht für viele (oder zumindest natürlich für den Autor) sprechen, die des Lebens, eines So-Lebens, müde geworden sind oder sich wenigstens sehr ermüdet fühlen (wobei ich hier gar nicht an das Burnout-Syndrom denke):
Ich will, weil ich mich so fühle. Das Gefühl ist der Grund, warum ich sterben will. Ich bin hier, weil ich sterben will. Deswegen bin ich in einem Zimmer ohne Fenster, mit vergitterten Glühbirnen und ohne Schloss an der Klotür. Deswegen hat man mir Gürtel und Schnürsenkel weggenommen. Nur das Gefühl nimmt man mir nicht weg, oder?
Obwohl sie dem Arzt zu Anfang mit keinerlei spürbarer Reaktion begegnet, öffnet er in seiner Behutsamkeit, gleichzeitig Beharrlichkeit, und weil er ihr als Arzt-Mensch begegnet, eine Tür, weiter und genauer von sich zu sprechen. Sie erklärt, so wie sie sich fühle, sei das eher Grauen als Traurigkeit. Ihr sei, als geschehe gleich etwas unvorstellbar Furchtbares, und ihr sei, als müsse man alles tun, um es zu verhindern. Und dann schließlich kommt sie auf das Kotzen, darauf, dass nicht nur ihrem Magen, sondern dass allen Teilen, jedem noch so kleinen jeder Teile, aus deren Fülle sie besteht, so sei, als müssten sie insgesamt nur eines: kotzen.
5
Man liest und kämpft sich voran in dem dicken Wälzer. Den man gar nicht lesen würde, täte man es nicht in einer Gruppe gemeinsam. Zumindest insofern gemeinsam, dass man sich jeden vierzehnten Tag trifft und austauscht über den Fortschritt in Mühen und Erkenntnissen. (Umwälzen: Das Buch wälzt nicht die Dinge um, aber es vermeldet ihren Stand und wälzt vielleicht den Blick auf manche Dinge um.)
Aber – ist es überhaupt wahr, was ich im vorangegangenen Abschnitt über die Begegnung zwischen – nicht namentlich bezeichnetem – Arzt und suizidaler Patientin niederschrieb? Ist es nicht eher so, dass der mit allem Recht nicht namentlich genannte Arzt (denn vielleicht ist er gar nicht genug Mensch-Arzt und wahrscheinlich ist es so, dass er nicht noch einmal in den Weiten des Wälzers auftauchen wird) Gefühle und Mitfühlen – beides nur in einem bestimmten „professionellen“ – Maß erlebt? Dieser Verdacht entsteht in mir, und ich lese den Abschnitt ein weiteres Mal. Und mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Warum hatte ich gemeint, gerade in diesem Abschnitt nichts von David Foster Wallaces Humor und von dessen bissiger Satire zu finden?
Ich ging nun folgendermaßen vor: Ich las nur die Teile, mithin sogar nur die Sätze des Textes, die den Worten, der Mimik, Gestik und Aktionen des Arztes gelten. Ich nahm also nur diese Sätze heraus (und ich bin mir sicher, ich würde wieder auf Ironie und Sarkasmus kommen, nähme ich mir nur den Teil des Romanausschnitts vor, der sich allein Kate Gompert widmet). Ich möchte ein paar von diesen Sätzen vorstellen, wobei die selbst sich weit verstreut auf den einzelnen Seiten wiederfinden.
Die meisten Ärzte betreten die Bühnen ihrer Berufsausübung mit forscher Munterkeit … Wenn ein Arzt einen Untergebenen anspricht, muss er einem ungeschriebenen Gesetz zufolge gleichzeitig lesen oder wenigstens auf sein Klemmbrett schauen, als studierte der Arzt eifrig die Flüssigkeitsbilanz … Jetzt hier auf der 5, seiner gegenwärtigen Bühne … Der Arzt wählte seinen zweitbesten Kugelschreiber aus der stattlichen Reihe von Kugelschreibern in der Brusttasche seines weißen Kittels … In den Augen des Arztes lag echtes, wenn auch abstraktes Interesse … Einen Augenblick lang sah der Arzt, der alles mitschrieb, eher fasziniert als besorgt aus … Handschriftliche Notizen zog er einem Laptop vor, weil er fand, dass Ärzte, die bei Patientengesprächen in ihre Laptops tippten, gefühlskalt wirken … Der Arzt betrachtete sie mit einer Geduld, die sie mitbekommen sollte.
Und natürlich äußert der Mediziner im Gespräch auch Banalitäten wie solche: „‚Angst macht einen Großteil von Panikattacken aus‘, bestätigte der Arzt“, der übrigens immer und stets „der Arzt“ bleibt und nie mit „der Mediziner“ oder Ähnlichem bezeichnet wird. Nur einmal, da ist er eben „AiP“ (Arzt im Praktikum). Wir erleben die große Distanz des Autors gegenüber Ärzten, denen man auf einer Psychiatriestation begegnet. Und: Ich hatte beim ersten Lesen gemeint, auf diesen 6, 7 Seiten innehalten zu können, auf dieser nicht-satirischen Insel im satirischen Meer.
6
Unbedingt will ich hier den Zorn nennen, die Unfähigkeit zum Zorn, die Wut nennen, die Unfähigkeit zur Wut. Ich möchte hier den Chor nennen, der auch in David Foster Wallaces Buch existiert. Den Chor der jetzt erschöpften, übermüdeten – zünftigen – Tennisprofis. Denn sie werden ja in der E. T. A., die eine sehr erfolgreiche Tennisakademie ist, herangezüchtet. Komik genug ist hier, dass sich der Chor der Jünglinge auf den Kacheln zwischen Toiletten, Duschen und Spinden fläzt, da die Jungen nach dem Großteil ihres Tagespensums nicht mehr weiterkönnen. Man bewundert sie für ihre Ausdauer, für ihren herangezüchteten Willen, man sieht sie alle als eins an – als den Jugendlichen, der, obwohl privilegiert, schon jetzt nicht mehr weiterweiß. Was wird aus ihm werden als Erwachsener? Was wird aus ihm werden in den Mühlen des Profisports? Wird es ihm je gelingen, über den Tellerrand hinauszusehen, sich zu erheben und sein Leben einmal von oben zu betrachten? Und wenn es ihm gelingt – wird es nicht zu spät sein? Der Autor selbst war sehr erfolgreicher Tennis-Profi im Juniorenbereich. Irgendwann hat er diese Sache, diese Rolle nicht weiter verfolgt. Aber die Jungs, hier auf den Kacheln sitzend, die Köpfe vor Erschöpfung hängen lassend, bar aller Kraft, aus sich selbst herauszutreten und sich zu betrachten, bar aller Zukunftsvorstellungen außer der einen, außer dem Tunnelblick, sie – die Äußerungen ihres Chores – wirken stark wie auch sonderbar glücklich wie auch nachvollziehbar sehr unglücklich und eigentlich recht ohne Perspektive außer der einen. In dieser einen möglichen Zukunft muss es, soll es unbedingt gelingen. Wenn man ihre Stimmen hört, den Wunsch nach einer Pause, nach einer längeren Pause, einem Wochenende, das man wirklich so nennen kann, den Wunsch nach Sex und ihre ach so starke Wunschlosigkeit, so muss man auch an die Sucht denken als Perspektive. Sie erscheinen hier als besonders einseitig ausgebildet – einseitig wie dieser eine Arm an jedem, der „hypertrophierte“ Tennisarm. Aber im Vordergrund steht vor allem ihre Erschöpfung, in der sie nicht weiterwissen und gar nicht weiterwissen können als bis zum nächsten Wochenende. So wie es vielleicht bei vielen anderen in ihren Jobs in unserer Gesellschaft aussieht.
7
Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Die vorhin doppelt kommentierte Szene fesselte mich, weil ich selbst fünf Jahre in einer Berliner Psychiatrie arbeitete. (Man könnte viele andere Szenen vorstellen, von denen nicht wenige einzelne – jede für sich genommen – jeweils eine sehr gute und literarisch reiche Shortstory erzählen.) Ich traf damals auf die vielen kleinen Katastrophen, die – jede für sich genommen – für den betroffenen Menschen selbst nichts anderes als eine große Katastrophe war. Und die Summe der kleinen Katastrophen in diesem Buch vom Spaß kommt einer einzigen großen gleich. David Foster Wallace zeigt nicht allein das Innenleben der psychiatrischen Anstalt, er zeigt Vieles vom Innen des großen Kontinentes Nordamerika. Er zeigt vor allem die allgegenwärtige Sucht. Jede Sucht: ein „Spaß“. Das Vergnügen jedoch an deren sehr kunstfertiger Schilderung und zynischer, gekonnt satirischer, ironischer, gleichzeitig zwiespältiger Darstellung ist tatsächlich unendlich.