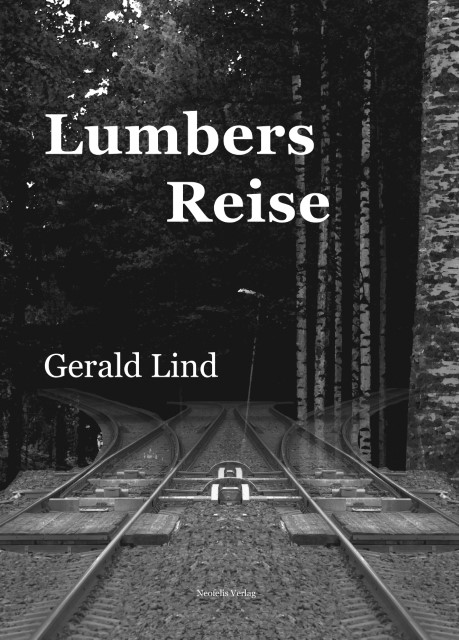Follow the white rabbit!
Gerald Linds Erzählen-über-das-Erzählen-über-das-Hoffen-auf-die-bessere-Welt
Mit Lumbers Reise von Gerald Lind liegt der zweite Roman des Grazer Literaturwissenschaftlers und Autors vor; der erste hieß Zerstörung und war ein zum Buch geronnenes Abfeiern des infiniten Regredierens in den Fußnotenspalten der geisteswissenschaftlichen Texttradition, völlig losgelöst von der Erde bzw. zumindest vom Primärtext; oder war‘s eine Kritik dieses Abfeierns, oder ein Abfeiern der Kritik … ? Jedenfalls war es eine getreue Nachbildung jenes Vorgangs, bei dem der Wissenschaft ihr Gegenstand abhandenkommt. (Siehe schreibkraft 27.)
Lumbers Reise eignet ebenfalls diese Dimension, das Anschauungsstück zu einer These herzugeben oder (etwas tiefer gehängt) mindestens zu einem Kapitel Theoriegeschichte; doch der Fall liegt zugleich einfacher und komplexer als bei Linds Erstling. Einfacher, insofern Lumbers Reise im Gegensatz zu Zerstörung dann außerdem doch noch ein Narrativ aufweist, mitsamt einem bestimmten Protagonisten, der zwar literaturtheoretisch multipel codiert, aber wenigstens greifbar ist, und einer erstmal unproblematischen Erzählsituation. Komplexer ist das Buch insofern, als das, was Lind uns vorführen zu wollen scheint, nicht bloß das „kleine“ Missverhältnis zwischen einer Fachsprache und ihrem partikularen Gegenstand ist. Stattdessen geht es um das viel größere Missverhältnis zwischen den letzten paar hundert Jahren Erzähltradition (also dem Vorstellungsvermögen des Gattungswesens Mensch) und der Wirklichkeit, die bzw. gegen die wir uns erzählen; zwischen individuellem Hoffen, gemeinschaftlichem Theoriemachen und realer Sozialisation.
Ein Samuel Lumber (ah, denkt sich der gewitzte Leser: „S. Lumber“, Sch. Lummer und ein Scheit Holz zugleich) entsteigt einem in Upstate New York auf der Strecke liegen gebliebenen Zug, um den weißen Hasen einer jungen Mitreisenden zu suchen … nein: überlebt ein schweres Zugunglück und stakst verwirrt davon in einen herbeihalluzinierten Märchenwald … ist er jetzt ohnmächtig und wir sehen seinem Weg durchs eigene Gehirn, zurück zu Bewusstsein, zu? … oder tapst er durch die tatsächliche Gegend, und sein Zustand verzerrt reale Begegnungen ins Traumartige? … nein, alles falsch: S. Lumber ist tot und fährt durchs Jenseits. Oder? (Es gehört das „Oder?“ notwendig zur Inhaltsangabe, eh klar.)
Eine solche Anordnung bietet nun die Möglichkeit zu allerhand formalen und den Erzählrahmen betreffenden Spielchen, zu Zitaten, Anspielungen und falschen Fährten aus dem Fundus der Literaturgeschichte (wobei die Möglichkeiten und weltanschaulichen Implikationen bestimmter Erzählkonventionen bzw. Ästhetiken immer mitgemeint sein werden …).
Wenn Lind es dabei beließe, wäre das alles sehr gescheit – und ausgesprochen langweilig. Zum Glück hat das Buch ein Thema auch noch: Utopien. Denn der tatsächliche Inhalt jener mehrfach verschachtelt-eingerahmten Jenseitsländer sind die diversen abgelegten Utopien, die zur Geschichte der Aufklärung im weiteren Sinne gehören, und was an ihnen, an ihren Narrativen, jeweils im Einzelnen nicht stimmte. Das mag als polemisch gewendeter Strukturalismus aufgefasst werden – narrative Konstrukte von kongruent kaputten Hoffnungsbildchen, die jeweils ihr Scheitern verlässlich mit-hervorerzählen, sind außerhalb dieses Buchs keine gültigen Argumente gegen die je einzelne Hoffnung – als Roman funktioniert das allemal.
Langer Rede kurzer Sinn: Dass Linds Erzählen-über-das-Erzählen-über- das-Hoffen-auf-die-bessere-Welt (z. B. jenseits der irdischen Dimension) gelegentlich als etwas selbstverliebtes Spiel mit Referenzgrößen erscheint, hindert uns nicht daran, Lumbers Reise ausgesprochen unterhaltsam zu finden.