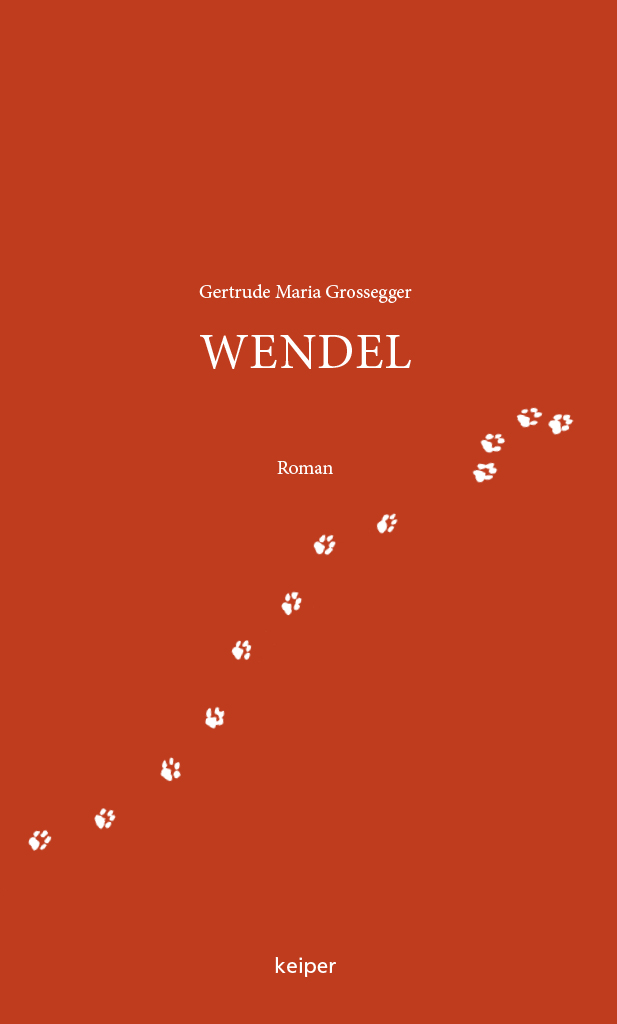Keine Welterklärer
Gertrude Maria Grosseggers Protagonist Wendel ist beschäftigt, sich selbst zuzuschauen.
Wendel ist der Protagonist des Romans, ein Wissenschaftler, der in seinem Labor in Gamspichl am Schweigergut an Forschungsprojekten arbeitet. Gewöhnlich trägt er seine Forschungsergebnisse öffentlich vor, ein Projekt jedoch hält er geheim. Von diesem inoffiziellen Projekt darf niemand erfahren, deshalb hat Wendel dafür ein Labor als Lagerraum getarnt. Wendel versucht dort, Herr über sein Unterbewusstsein zu werden, das ihn seit seiner Kindheit mit Albträumen plagt. An der Oberfläche scheint in Wendels Leben alles in Ordnung zu sein. Mit seiner Frau Marie hat Wendel drei Kinder, er hat Freunde, mit denen er ab und zu etwas unternimmt, und auch das geheime Projekt scheint gut zu funktionieren, bis eine merkwürdige Übergabe Wendel aus der Bahn wirft.
Schon beim Lesen der ersten Seiten von Wendel fällt der lyrische Sprachstil des Romans auf. Die Sprache von Gertrude Maria Grossegger zeichnet sich durch ein besonderes Gespür für Wortspiele, Wortklang und Sprachrhythmus aus. Beim Lesen des Romans scheint es, als würden sich Inhalt und Sprache gegenseitig bedingen. Die Gedankengänge Wendels sind stark von Assoziationen geleitet, welche von der dichterischen Sprache hervorgerufen werden und welche ihrerseits gleichzeitig eine dichterische Sprache fordern.
Die Autorin spielt mit der wörtlichen, sprichwörtlichen und metaphorischen Bedeutungsebene der Wörter, wenn es heißt: „ein Lied könnten sie darüber singen, wenn sie singen könnten“, oder: „Er, der Wendel, steht noch, wie auf der Leitung steht er da, steht und steht.“
Es ist ein Herantasten an die Sprache. Hält der Satz, was er an Bedeutung verspricht? Die Worte werden in ihrem Sinn geprüft, gedreht, verkehrt dargelegt, bis sich ein neuer, im Wort verborgener, aber immer schon da gewesener Sinn erfassen lässt: „Und in vielen Fällen sind es Fallen, in die auch Wendel immer wieder hineingerät, weil solche Fälle meistens etwas sind, die unvorhersehbar über einen herfallen, sonst wären es keine Fallen“. Es ist ein Abklopfen der Sprache auf Sinnhaftigkeit und Widersprüchlichkeit, in dessen spielerischer Leichtigkeit eine Tiefe liegt, welche uns zum Innehalten zwingt. Erstaunlich ist besonders der Wechsel zwischen Abstraktem und Konkretem. Was eben noch weit weg war, ist plötzlich greifbar. Und was eben noch konkret war, steigt Schritt für Schritt auf, bis es sich nicht mehr ganz fassen lässt.
Unscheinbare, alltägliche Handlungen werden zu einem Auslöser für philosophisch-sprachliche Reflexionen. Das Klingeln eines Telefons sorgt dafür, dass Wendel abhebt: „Wendel hebt ab, und manchmal so stark, dass es ihn aushebt, aber so wie jetzt wird es ihn noch nie ausgehoben haben. Wendel hebt ab, immer wieder. Eben nicht nur den Hörer […].“ Der Roman ist in 28 Kapitel von überschaubarer Länge gegliedert. Im Verlauf der Handlung finden sich viele Rückblenden, welche den Einstieg in die gegenwärtige Handlung erschweren. Der Leser wird mit einem Textstrom konfrontiert, dessen weitschweifige Gedanken nicht immer leicht einzuordnen sind. Der Erzähler springt gerne: nach vorne, zurück oder in irgendeine Richtung, die die Erwartungen sprengt. Die Gedankenketten entstehen durch Assoziationen und Vergleiche: Das Verblassen von Erinnerungen erinnert Wendel an die Lebkuchenkekse, die weicher werden, das Innere eines Menschen vergleicht Wendel mit einem Druckkochtopf.
Weder Wendel noch der Erzähler der Geschichte maßen sich an, „Welterklärer“ zu sein. Der Erzähler ist ein Versuchender, ein Spielender. Er korrigiert und relativiert seine Aussagen, erzählt sie neu und erzählt sie anders, wodurch die Interpretation dem Leser überlassen wird: „Zurzeit ist der Wendel beschäftigt, sehr beschäftigt, aber nicht so wie sonst, nein, das nicht, dann tät er, der Wendel, ja jetzt auch was tun, nein, er ist beschäftigt, sich selbst zuzuschauen.“ Und schließlich fordert der Erzähler den Leser dazu auf, dem eben noch Behaupteten zu misstrauen, etwa wenn es heißt: „So wird es wohl gewesen sein, oder ganz anders.“ Gertrude Maria Grossegger macht uns auf 132 Seiten mit Wendel bekannt, und zwar nicht nur mit einem Wendel, sondern mit vielen verschiedenen: mit einem Traumwandler, einem Durchhalter, einem Tatkräftigen, einem Ausgelieferten und einem Feinsinnigen, und auch mit solch einem Wendel, von dem nicht nur wir, sondern auch Wendel selbst nicht gedacht hätten, „dass so ein Wendel auch in ihm steckt“.