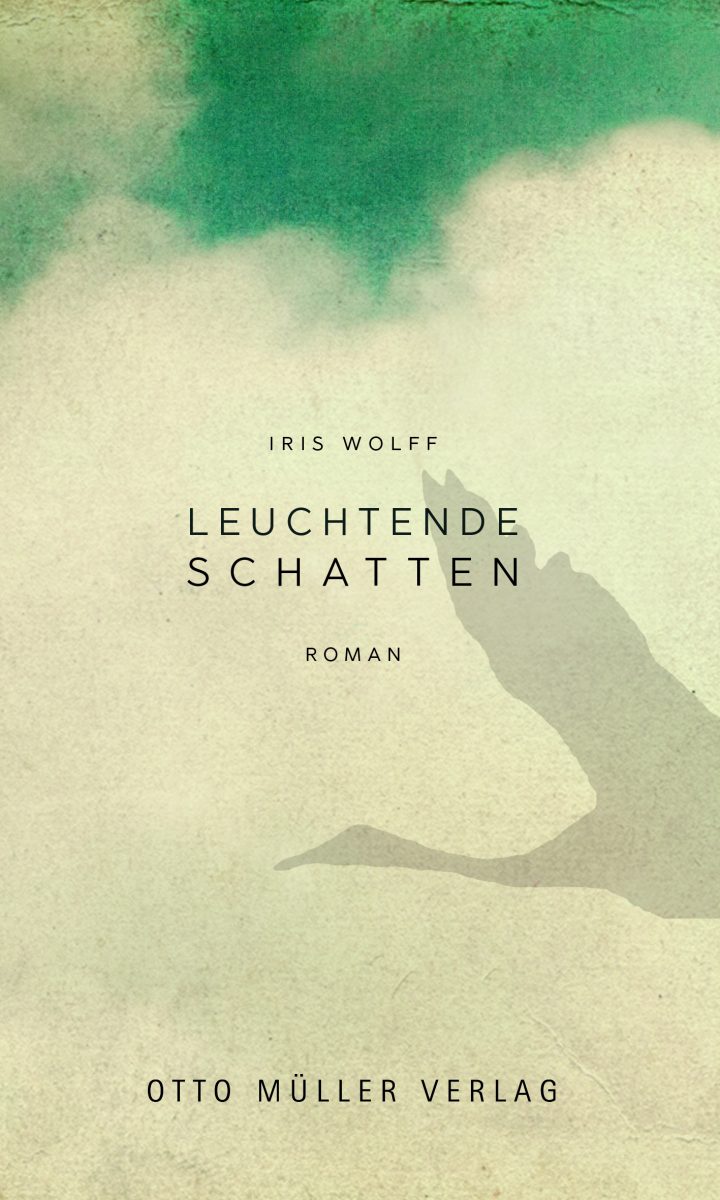Ode an die Freundschaft
Das Ende einer Kindheit, auf die die Vergangenheit Rumäniens ihr Licht und ihren Schatten wirft
Leuchtende Schatten heißt der zweite Roman der in Hermannstadt/Siebenbürgen geborenen und in Freiburg lebenden Iris Wolff. Wer sich einen genreüblichen Abgesang auf das Ende der Siebenbürger Sachsen in Rumänien erwartet, sollte das Buch rasch wieder zur Seite legen. Wolff schafft es nämlich, dem Leser das siebenbürgische Hermannstadt und ein Dutzend seiner Bewohner derart einfühlsam und eindringlich vorzustellen, dass man, wenn man sich auf die Geschichten dieser Menschen erst einmal eingelassen hat, nicht mehr davon lassen will. Iris Wolff gelingt mit diesem Roman eine anmutig-poetische Ode an und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Freundschaft. Wie bereits in ihrem ersten Roman Halber Stein beeindruckt Wolff auch in Leuchtende Schatten mit einem bescheiden-klugen Blick auf die Geschichte der sogenannten Rumäniendeutschen und der Kunst, genaue Beobachtung in subtil gezeichnete Schilderung umzusetzen. Ganz behutsam dreht Iris Wolff ihr in einer klaren und einfachen Sprache vermitteltes Familienkaleidoskop und ihr gelingt auf diese Weise ein stilles, unspektakuläres, aber umso länger nachwirkendes Buch über die Einsamkeit der Menschen in der Gemeinschaft, aber auch über die Unantastbarkeit des Freiheitswillens und den Wert von Freundschaft und Liebe.
Trauer und Euphorie
Wolffs Roman erzählt von den Veränderungen und Herausforderungen, die die Bewohner im siebenbürgischen Hermannstadt in den 40er-Jahren umtreiben, besser gesagt, fällt diese Aufgabe dem Mädchen Ella zu, das als auf das Geschehen zurückblickende Ich-Erzählerin vom Hereinwirken der weltpolitischen Ereignisse auf die vermeintliche Siebenbürger Idylle berichtet. Das ideologische Gift des Nationalsozialismus beginnt in die Großfamilien einzusickern, zwischen den ethnischen Gruppierungen entsteht mehr und mehr Misstrauen und eine diffuse Angst hält Einzug in den einst beschaulichen Alltag. Für Ella sind es neben den vertrauten Orten vor allem ihr nahestehende Personen – ihre Eltern, ihre Cousine und ihre Großmutter –, die ihr Orientierung und Rückhalt bieten. Mit ihrem Vater verbindet sie die Liebe zur Sprache und zur Literatur und ihre ebenso liebenswerte wie resolute „Ursula-Oma“ bewahrt auch in den Umbruchszeiten Haltung und bezieht Stellung, wenn nicht wenige der deutschen Volksgruppe auf einmal das Gefühl haben, „Teil eines großen, ruhmreichen Ganzen zu sein“. Im Zentrum des Romans steht aber die tiefe, in ihrer Intensität für den Leser fast spürbare Freundschaft zweier Mädchen. Mit einem Unfall am See beginnt die Freundschaft zwischen Ella und Harriet, die sich trotz ganz unterschiedlicher Vorgeschichte und Elternhäuser sofort auf fast sinnliche Weise vertraut sind und sich vom ersten Augenblick an verbunden fühlen. „Ich liebte Harriet vom ersten Augenblick an“, lautet der erste Satz des Romans. Die politischen Ereignisse in den Jahren 1943 und 1944, aber auch private Weichenstellungen, zwingen die Mädchen aber sehr rasch und unsanft von ihrer Kindheit Abschied zu nehmen. Harriet wird von einer Mitschülerin mit den Worten „Weißt du, was wir hier gar nicht mögen? – Streunende Hunde, Zigeuner und Juden“ angegriffen und der Druck auf Ellas Vater „ins Feld zu ziehen“ wird von Tag zu Tag stärker – als er sich schließlich für den Einsatz entscheidet, heißt das auch, dass er nicht mehr nach Hause kommen wird. Auch Leo, Ellas erste große Liebe, stellt die intensive Freundschaft der Mädchen auf eine große Probe, aber nie in Frage. Der von Iris Wolff sehr eindringlich geschilderten Spannung zwischen Trauer und Euphorie, zwischen der ersten Verliebtheit und dem Tod des geliebten Vaters, den vertrauten Zufluchtsorten und den sich ändernden Rahmenbedingungen (die Kluft zwischen völkischen Sachsen und kommunistisch-nationalistischen Rumänen wird immer größer) steht der Freiheitswille und die tiefe Freundschaft zwischen den Mädchen gegenüber. „Glück wird durch Leid nicht aufgehoben“ und „Man kann sich immer entscheiden, welche Geschichte man erzählen will“, lässt Iris Wolff den Leser durch die Ich-Erzählerin Ella wissen. Die Wege von Ella und Harriet trennen sich schließlich wieder – viele Jahre später erhält Ella einen wortlosen Gruß aus New York, eine Halskette mit einem Anhänger, der die Initialen von Harriet eingraviert hat. Mag sein, dass das Resümee des Buches ein wenig traurig lautet: Jeder lebt letztlich für sich alleine. Die Kunst von Iris Wolff, ihren Personen mit Liebe und Respekt zu begegnen, sich in sie hineinversetzen zu können und sie und ihr Handeln dem Leser nachvollziehbar und verständlich gemacht zu haben, ist dann doch ein ebenso wichtiges wie tröstendes Gegenargument.