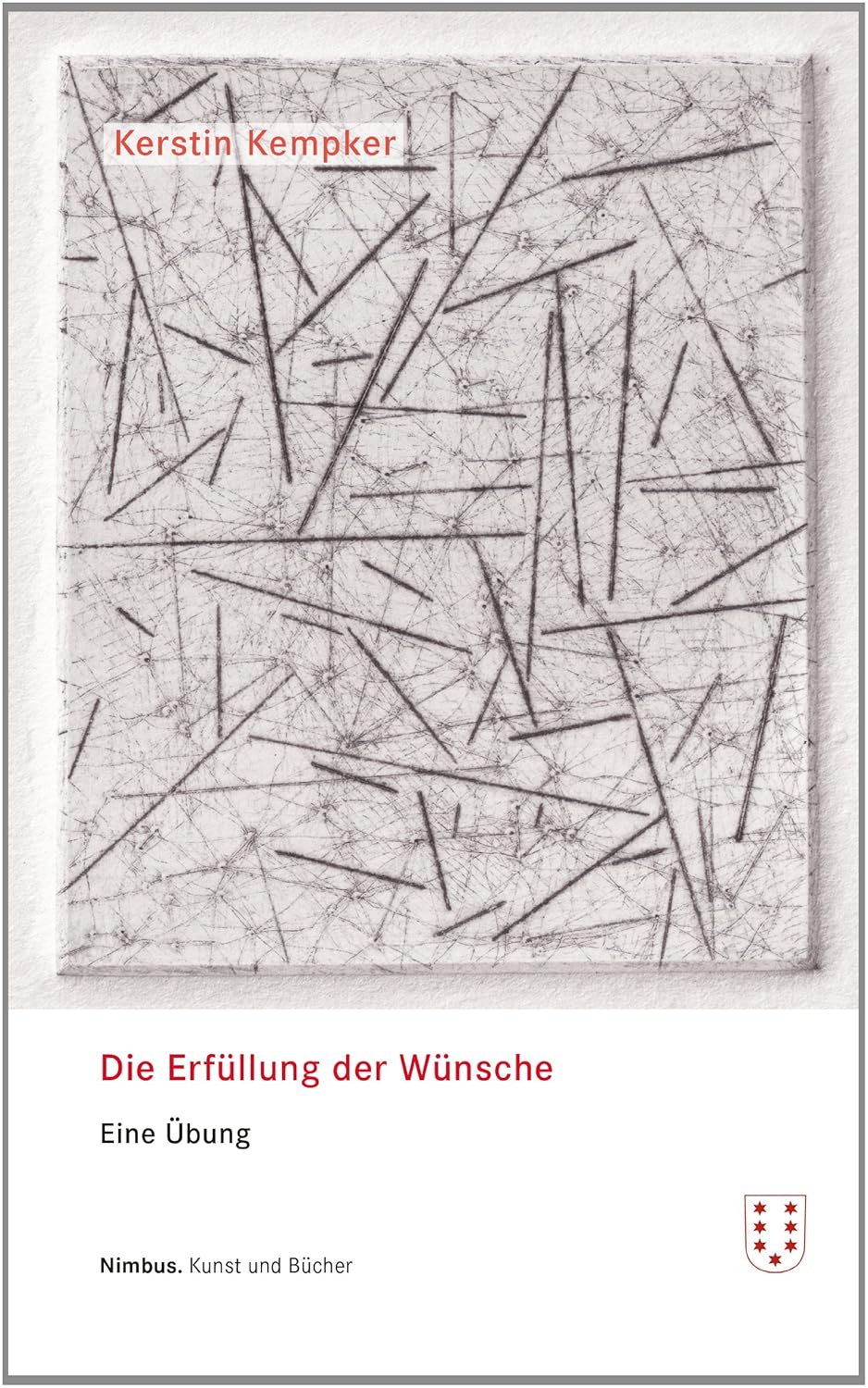Revolte im Krankenhaus
Eine Fantasie mit fließenden Grenzen
Der Schauplatz: ein Krankenhaus mit dem für sich sprechenden Namen „Moribundes“. Die Erzähler: eine berichtende Instanz, die die relevanten Schauplatzstationen und das Geschehen näher beschreibt. Eine Ich-Erzählerin, die nach einer Untersuchung einen Befundbrief besagten Klinikums erhält. Und dann noch eine zweite Ich-Erzählerin; eine aufgrund ihrer Fast-Kahlheit offenbar krebskranke Patientin, die sich gemeinsam mit anderen Kranken gegen den Klinikbetrieb auflehnen und für titelgebende Erfüllung der Wünsche eintreten wird. Das allerdings nur in der Fantasie ersterer Erzählerin, da diese, anstatt den Befundbrief zu öffnen, den Inhalt und die möglichen Auswirkungen desselben als „Übung“ lieber erst einmal im Kopf durchspielt, und zwar durch die Person der beinahe Kahlen.
Erzählerin Nummer eins legt als autodiegetische Erzählerin also ihre eigene Geschichte dar – bis zum Zeitpunkt, an dem sie den Brief schließlich öffnet. Erzählerin Nummer zwei berichtet als homodiegetische Erzählerin ihrer scheinbar komatösen Zimmergenossin Roswitha, was sich im Krankenhaus abspielt und wie die Revolte voranschreitet – wenngleich auch bereits in der Fantasie der Erzählerin Nummer eins. Und der heterodiegetische, also außerhalb der Personenhandlung stehende, Orts- und Zeitrahmen festlegende Erzähler existiert ebenfalls nur in der Fantasie derselben.
Raffiniert konstruiert und folglich auch ziemlich komplex: Der neue Roman der deutschen Autorin Kerstin Kempker ist nichts für Schnellleser und Überflieger. Wer leichte Literaturkost bevorzugt, ist bei dieser Erzählung an der falschen Adresse. Wer allerdings bereit ist, sich einen Weg durch das oben zu lichten versuchte erzähl-theoretische Wirrwarr und das Labyrinth aus gekonnt pointierten Sprachbildern, indirekten Andeutungen und Gedankenfetzen zu suchen, wird garantiert belohnt werden. Denn so undurchsichtig sich die Handlung auch manchmal präsentiert: Die ungebremst fließende, metaphorische Sprachgewalt macht diesen Text wirklich zu etwas Außergewöhnlichem.
Auch die Tatsache, dass der Inhalt teilweise doch ziemlich verwirrend anmutet, bedeutet nicht, dass er nicht zu überzeugen vermag. „Die Erfüllung der Wünsche, das war einmal eine duftige Melange aus Märchen und Glaube, eine tröstliche Vorstellung von der Macht der Verlorenen, Gerechtigkeit und anderen Wundern“, schreibt Kempker, nachdem die Wünsche „von der Galerie laut verlesen und an die Erfüller verteilt“ worden sind. Sie beziehen sich auf ein bisschen mehr Menschlichkeit, auf ein bisschen weniger Oberflächlichkeit im Krankenhausbetrieb. Denn kein Patient möchte verdinglicht werden, möchte nur ein Fall unter vielen sein. Das hat die in Wuppertal geborene Kerstin Kempker – früher Sozialarbeiterin, danach Sachbuch- und heute Belletristikautorin – in diesem Roman auf kritische, aber humorvoll pointierte Art und Weise zu verdeutlichen geschafft. Ein durchaus zu empfehlendes Werk, sowohl inhaltlich als in erster Linie auch aufgrund des absolut überzeugenden, faszinierend poetischen Sprachgebrauchs.