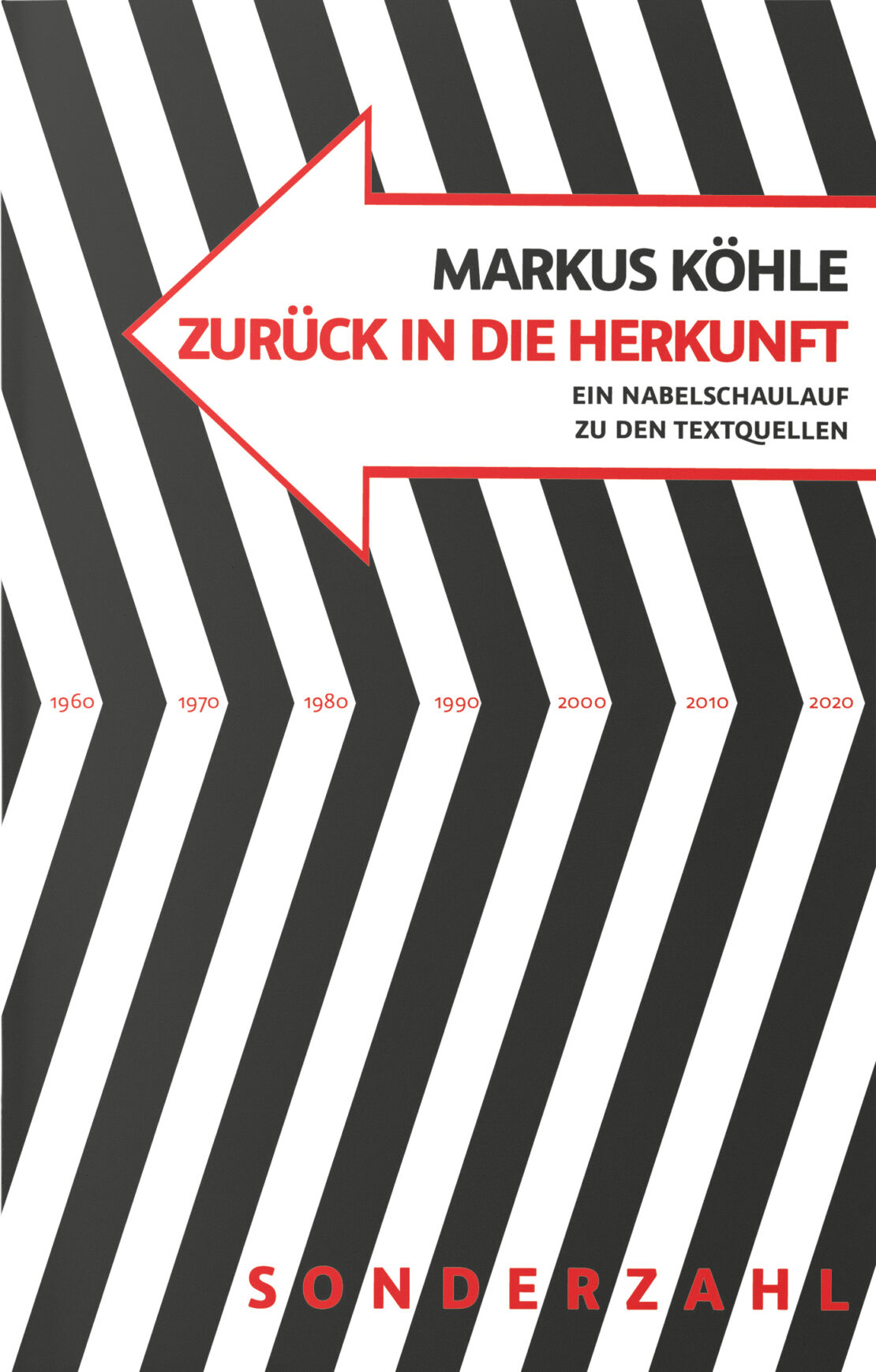Best of Poetry
Markus Köhle wird in Zurück in die Herkunft zum Plagiatsjäger seiner selbst.
Ok, über Slam-Poetry bedarf es hier keiner großen Worte. Dass Poesie als performative Kunst gelebt und in niederschwelligen Live-Formaten gerockt wird, hat hierzulande eine Tradition, die – in dieser kompetitiven Form – gut 20 Jahre alt sein dürfte. Verantwortlich dafür sind an vorderster Front Künstlerinnen und Künstler wie Mieze Medusa oder Markus Köhle, die der Sache schon früh einen Stups gaben und sie bis heute kuratorisch wie auch als Akteure begleiten. Köhle hat nun bei Sonderzahl ein Buch vorgelegt, das als Blick auf die literarische Verwurzelung seines eigenen Schreibens und seiner performativ gelebten Poesie in vieler Hinsicht aufschlussreich ist. Zurück in die Herkunft nennt er diesen seinen „Nabelschaulauf zu den Textquellen“.
„Ich komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes“, hat ein gewisser Peter Handke (nicht zu verwechseln mit dem Wiener Finanzstadtrat, der heißt nur so ähnlich) bekundet und sich oder seine Standpunkte damit im Bereich immerwährender Bedeutsamkeit verortet. Da tickt Köhle ganz anders, wenn er seine literarische Herkunft thematisiert. Schließlich versteht sich die Slamily, wie sich die (Poetry-)Slam-Blase liebevoll selbst tituliert, als Fluchtbewegung aus dem Elfenbeinturm und legt gern mal Wert auf ernst gemeintes Understatement. Wenn Markus Köhle in seinem Buch also augenzwinkernd zu einem Ausflug in die jüngere Literaturgeschichte einlädt, in dem er sein ganz persönliches Verhältnis zu einigen ihrer kreativsten Vertreter offenlegt, so ist diese Annäherung oft irgendwo zwischen liebevoller Verhunzung und verspieltem Plagiat einzuordnen. Absichtsvoll outet sich Köhle hier als Epigone – von so vielen (und so vielen Großartigen) wie Gert Jonke, Elfriede Gerstl, Gerhard Rühm, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl, Bodo Hell, Otto Grünmandl. Aber er reibt sich auch an Thomas Bernhard, lässt uns Heidi Pataki entdecken und Rose Ausländer, verhält sich zu Barbara Frischmuths Garten und deutet Herkunft immer wieder auch außerliterarisch: bezogen auf seinen Geburtsort Nassereith im Tiroler Transit-Bezirk Imst oder auf die dortige – ebenfalls recht epigonale – Grungekultur der 1990er-Jahre.
Slam-Texte – und als solche kommen die meisten in diesem Buch daher – präsentieren sich dabei auch als Hallraum und Fleischwolf für all das Gelesene, das dem Autor im Kopf herumhüpft und -spukt. Zugleich erhalten Köhles rotzige Gratwanderungen zwischen Genie und stilistischer Genügsamkeit ein Referenzsystem, das dazu einlädt, sie genauer zu betrachten, als es die Performance-Situation sonst zuließe. (Dennoch gewinnt das Buch zweifellos, wenn es mit gutem Tempo und ausreichend laut der Nachbarschaft vorgetragen wird.) Dabei leuchten immer wieder literarische Glücksmomente auf, die zu entdecken sich absolut lohnt! Und last, but not least versammelt Zurück in die Herkunft zwischen seinen griffig-weichen Buchdeckeln (Umschlag von Matthias Schmidt) eine wunderschöne Zusammenschau schwerpunktmäßig österreichischer Sprachkunst, die so noch nie vor- oder nachgestellt wurde. (Da haben dann auch die Nachbarn was davon – bildungsmäßig sozusagen;)