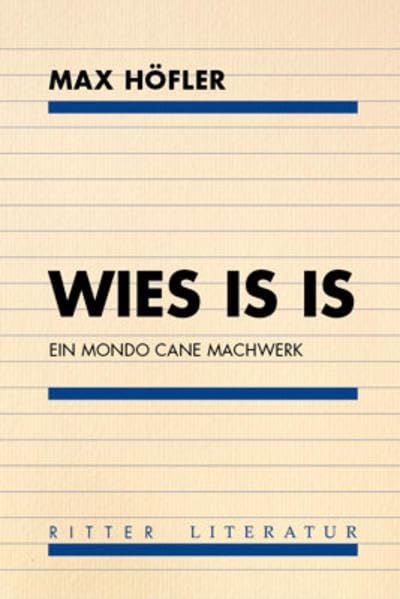Hundewelt mit Ninjas
Alle Zustände in einem langen Satz vereint
„Mondo Cane“, beauskunftet uns Wikipedia, „ist ein Pseudo-Dokumentarfilm aus dem Jahr 1962 von Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi und Paolo Cavara und gilt als Grundstein des Mondo-Genres.“ Aha. Man erinnert sich dunkel an Filme dieses Genres: Gesichter des Todes etwa machte klandestinerweise die Runde im Klassenverband, als ich ungefähr 16 war – wie ich heute weiß, ein blasser Abklatsch der „echten“ Mondo-Filme aus Italien, die, bei intaktem künstlerischen Anstrich, das Exploitation-Kino auf die Spitze trieben. Dem Original und seinen zahlreichen Kopien war gemeinsam, dass sie keine Handlung im engeren Sinne hatten, sondern als Bilderbögen über die weltweiten Ausformungen dieses oder jenes menschlichen Makels (Grausamkeit, Rohheit, Dummheit, Aberglaube usw.) daherkamen. „Eigentlich“ aber waren sie schlichte Voyeurismus-Vehikel, die mit den Grenzen zwischen filmischer Inszenierung, Dokumentation und Snuff ebenso spielten wie mit dem prekären Unterschied zwischen Zuschauer und Mittäter dieser oder jener Grauslichkeit (man beachte an dieser Stelle bitte die Anführungszeichen, in denen das Wort „eigentlich“ steht – sie sind dem Umstand geschuldet, dass die Grenze zwischen „Kunst“ und „Exploitation“ in diesen Filmen nach beiden Seiten hin zerfasert).
Soviel zum Verständnis des programmatischen Untertitels von Max Höflers neuem Buch wies is is. ein mondo cane machwerk. Das Buch wird ihm gerecht. Sein Textsubjekt, ein diffuses „wir“, durchlebt grelle Szenen von Macht und Erniedrigung, agiert mal als verzweifelter Wichtigtuer, mal als Actionheld in verstiegenen Rachephantasieszenarien, mal als herrschende oder beherrschte „Klasse“ im klassischen Sinn (no pun intended) und verwandelt sich gelegentlich auch in eine bloße grammatikalische Funktion der Darstellung, dem ins Bild ragenden Schwanz in Point-of-view-Pornos gleich. Was alle die Szenen verknüpft, aus denen wies is is besteht, ist dabei nicht eine wie immer geartete Kontinuität in den Eigenschaften dieses Wir (eine solche nicht zu erwarten, lernt man beim Lesen schon auf den ersten paar Seiten) – das Buch stellt die Unmöglichkeit seines „Wir“, sich aufgrund von Erlebnissen zu „entwickeln“, geradezu aus. Das erzählerische Vor- her-Nachher-Paradigma ist suspendiert.
Die Verknüpfung der Szenen erfolgt stattdessen über den schlichten Umstand, dass sie alle in einem einzigen, interpunktionsfrei durchgetakteten, über zweihundert Seiten langen Satz vorkommen. So sehr also die einzelnen Szenen erzählerische Dynamik besitzen, so sehr bildet das Buch als Ganzes eine Art literarische Annäherung an eine synchrone Draufsicht auf eine Menge von Phänomenen. Der Buchtitel legt es nahe: So und so und so „ist es“. Das zwingt uns die Frage nach diesem „es“ auf. Der umgangssprachliche Buchtitel unterschlägt es, wie wir vermuten dürfen, durchaus absichtsvoll (oder sagen wir, er unterschlägt es nicht, sondern er stellt die Behauptung in den Raum, so umgangssprachlich und nebenbei ließe sich dieses „es“ eben nicht fassen). Fragen wir also: Für welche Totalität steht dieses „es“ in „wie es ist ist es“?
Der Autor selbst gibt auf mündliche Nachfrage die Auskunft: Der derzeit herrschende globale Kapitalismus. Genau das, genau so seien „wir“. Alle diese Szenen seines Buchs, auch und gerade die besonders phantastischen Episoden (beispielsweise der groteske Hollywood-Endzeit-Plot mit den Ninjas und dem Puppenhändler), stellen Zeug dar, das im Bewusstsein der Bewohner dieser schlecht globalisierten Welt so oder ähnlich rumliegt, und dieses Zeug bildet in seiner Gesamtheit die träge Masse, die verhindert, dass sich substanziell etwas ändert. So sähen sie aus, die realen oder halluzinierten Anfechtungen, denen „wir“ uns gegenübersehen, und mit ihnen zur Anschauung gebracht werden uns auch die scheinhaften und die echten Ausweglosigkeiten, aufgrund derer „wir“ handeln, wie wir „handeln“: Habitueller Machthaber-Sadismus schlägt um in sentimentale Weinerlichkeit schlägt plötzlich um in Existenzangst schlägt wiederum um in die Ausgesetztheit unter den Zugriff ermächtigter Sadisten mitsamt Stockholmsyndrom et cetera da capo.
Ich erlaube mir, dieser Antwort des Autors zu widersprechen, dass das in wies is is versteckte „es“ der Kapitalismus wäre, und basta. Was Höfler darstellt, ist mehr und anderes als der globale Kapitalismus in den Köpfen und realen Leben der Weltbewohner. Was er darstellt, ist meiner Meinung nach vielmehr der geschichtliche Moment, in dem ein prinzipiell „meritokratischer“ Kapitalismus (klar: auf der Grundlage von „Meriten“, über deren Nutzen und Frommen natürlich nochmal gesondert zu reden wäre …) in einen globalen Feudalismus kippt: Der Moment des Rollback, da der Kapitalismus verblödet und für die, sagen wir, „globale Bourgeoisie“ nicht mehr gilt, dass sie, mit den Worten des kommunistischen Manifests, „… an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt [hat]“.
Just die Wiederkehr der religiösen und politischen Illusionen scheint es mir zu sein, worum es in wies is is geht. Die kokett eingestreuten Momente „reiner“, in sich ruhender Ekelpornografie – etwa der Moment, da „wir“ ganz wörtlich Scheiße fressen, genüsslich und über zweidrei Seiten hin – ändern daran nichts. Freilich: Ob der genannte globale Rollback, den ich in wies is is dargestellt zu finden glaube, derzeit real vorliegt oder ob es sich bei ihm um eine Angstphantasie „kritischer Intellektueller“ der Ersten Welt handelt, wäre noch so eine eigene Debatte. Und die hat dann nichts mehr mit Höflers Buch zu tun. Denn die Frage nach der individuellen Einschätzung des Programms, das ein Autor in einem Buch mehr oder weniger stringent durchzieht, ist ja eine andere Frage als die, ob das Buch was kann – ob es sich angesichts der begrenzten Lebenszeit und des virtuell unbegrenzten Angebots an Büchern auszahlt, es zu lesen. Und da nun lautet die Antwort: unbedingt.
Es macht, unwahrscheinlicher- und vielleicht auch unpassenderweise Spaß. Dies erstens wegen der grotesken Natur vieler einzelner Szenen und zweitens, weil es lustig ist, zuzusehen, wie Höfler sprachlich operiert – wie er wieder und wieder die waghalsigen grammatikalischen und inhaltlichen Kurven kriegt, die man schon von Weitem kommen sieht. Zum Schluss eine Warnung: wies is is lässt sich mangels Kapiteln, Absätzen oder einer Handlung nicht leicht häppchenweise lesen. Es ist besser, sich einen Nachmittag und Abend lang Zeit dafür zu nehmen und das mondo cane machwerk in derselben Weise zu konsumieren wie die Filme, denen sich der Untertitel verdankt: als Ganzes, in einem Aufwasch, bis die Perspektiven und das Zeitgefühl verschwimmen und alles, alles, alles so gleichermaßen ausweglos-verzweifelt wie lustig auszusehen beginnt.