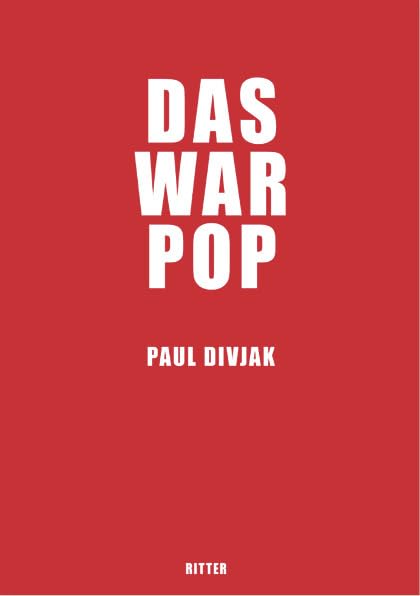Die Bewegung?
Die Bewegung zur Musik!
Es gab da ja mal die Erzählung vom großen Sell-out: Eine irgendwie vitale, nicht ausschließlich kommerziell orientierte musikalische Formensprache nebst einer Szene drumrum würde in einer Nische der Gesellschaft fröhlich vor sich hin existieren. Dann käme das Big Label und fütterte ein paar Künstler an. Deren Mucke würde nun immer verwässerter, inhaltsloser, marktgängiger. Gleichzeitig würden die Symbole und der Lifestyle der dazugehörigen Szene zu Statussymbolen für konsumfähige und identitätsbedürftige Mittel- und Oberschichtkiddys. Eine gewaltsame Öffnung der Schauplätze und Rituale der Szene fände statt; die freundlich gemeinte, de facto aber feindliche Übernahme eines ganzen sozialen Kontexts. Je bekannter, zitabler die Formensprache würde, desto schwieriger würde es, in ihr Relevantes zu verhandeln. Einfacher: Hungrige Künstler machten echte Musik, Künstler aber, die in Geld schwimmen, vergäßen ihre Wurzeln, und das klinge breiig, seifig, oberflächlich. So weit, wie gesagt, die Erzählung vom großen Sell-out. Nach ihrem Muster konnte man früher mal auf angenehm distanzierte Weise davon reden, wie sehr man eh auf der jeweils richtigen Seite irgendwelcher konkreter Konflikte stehe (Woody Guthrie oder Peter, Paul & Mary? Frühe oder späte Pink Floyd? Snoop Dogg oder Snoop Lion?). Doch das war mal. Sie hat – wie 2004 beobachtet von David Heath und Andrew Potter in ihrem Buch The Rebel Sell – im Lauf der Nullerjahre ihre Selbstverständlichkeit verloren. Will sagen: Die heute 18- oder 20-Jährigen – sie wissen so überhaupt nicht mehr, was du meinst, wenn du ihnen mit „Sell-out“ kommst.
Un- versus kommerziell: Diese Gegenüberstellung scheint nicht mehr recht zu gelten. Der Markt ist alles, was der Fall ist – das Universalmedium menschlicher Interaktion. Was sonst soll ein Künstler noch wollen können, außer sich auf ihm durchzusetzen? Paul Divjaks neues Buch, Das war Pop, lässt sich verstehen als literarische Abhandlung über diesen Umstand – als Beweisführung, seine Ursachen betreffend, und als Ausstellung über seine Folgen. Oder man kann es lesen als einen Versuch darüber, was innerhalb der Grenzen eines radikal oberflächlichen Jargons, mit maximal verkürzten Aufmerksamkeitsspannen, möglich ist – einerseits an genuin poetischen Momenten (einiges), andererseits erst mal nur an ernstlich Inhaltlichem (eher nicht gar so viel).
Womit haben wir es zu tun? – Der Band ist in fünf Kapiteln organisiert, die fünf verschiedenen Varianten der literarischen Methode des Cut-up entsprechen. Kapitel eins ist noch recht nah an den Prosagedichten der Frühgeschichte des literarischen Pop, an Brinkmann et al., und behandelt inhaltlich so etwas wie eine Zeit, da das emanzipatorische, antifaschistische Potential von Pop noch ungebrochen und fraglos war.
Kapitel zwei, der bei Weitem längste Abschnitt von Das war Pop, stellt eine Erzählung dar, in der ein paar Jetset- bzw. Kulturpromi-Arschgesichter umeinander kreisen und jedem persönlichen Wachstum, jeder praktischen Konsequenz eigenen Denkens und Fühlens weiträumig aus dem Weg gehen. Dieses Kapitel liest sich wie eine Montage aus Facebook-Kommentaren, Tweets und Hochglanzmagazin-Artikelüberschriften („10 Jahre noch und Julian Assange sieht aus wie Chet Baker. Aber süß ist der schon. Hat was, dieses Milchgesicht. Besser als Zuckermann. Würdest du den bumsen, Schätzchen? Na, ja. Nicht wirklich mein Typ. Aber, ey. Die Kohle möcht ich mal haben. OMG. Bin ich müde. Eine Runde um den Block. Ein Bier noch im Kater Holzig. Dann geht’s ab ins Bett. Schluchz, keiner liebt mich.“). Die Figuren dieses Kapitels leben in der sicheren Gewissheit, Definitionsmacht gepachtet zu haben; sie schwimmen geradezu in symbolischem Kapital, und sie nutzen es zu nichts und wieder nichts. Ihre „Identität mit sich selbst“ ist vollkommen, aber sie sind gerade deswegen sexy wie Sau und müssen nicht wissen, warum dieses Zitat an dieser Stelle eine Beleidigung darstellt. Deutlich trägt das zweite Kapitel den Charakter eines Schaustücks zum Beleg ungefähr folgender These: Unter den Bedingungen des Web 2.0, des permanenten sozialen Netzwerkens und des Zwangs zum kurzen, knackigen Echtzeit-Kommentar bleibe vom emanzipatorischen Potential von Pop nichts als die dröhnende Selbstgewissheit der High-Status-Idioten.
Kapitel drei ist ein Cut-up im engeren Sinn (d. h. sowohl in Hinblick auf das Verfahren als auch in Hinblick auf das Material), und zwar eines von Songtexten. Es leistet im Wesentlichen den Hinweis, dass es vor dem Hypertext des World Wide Web schon den Metatext der Songs gab – und das Verfahren des Zitierens.
Kapitel vier stellt einen experimentellen Prosatext auf Grundlage der Drehbuchform dar, mit „Echtzeit“-Einsprengseln von Tweets, SMS und Social-Media-Kommentaren. Wer will (lies: Wer seinen habituellen Kulturpessimismus zu bestätigen sucht), kann hier wohl so etwas finden wie den Umschlag vom individuellen Denken zum Hive-Mind.
Kapitel fünf präsentiert uns, als Teil des Textgebildes Das war Pop, die Geschichte von der Genese dieses Textgebildes selber: Wie der Autor Divjak mit anderen im Literaturhaus Wien eine Sampling-Session mit Popdiskurs-Büchern abgehalten – also pophaften Umgang mit Texten über Pop betrieben – hat. Das Kapitel besteht im Wesentlichen aus der Liste der bei diesem Anlass verwendeten Originaltexte. Als Endpunkt hinter den Beat (Kapitel 1), den Social-Media-Echtzeit-Code (Kapitel 2), den Metatext (Kapitel 3) und den Hypertext (Kapitel 4) setzt Divjak also das literaturwissenschaftliche Zitieren.
Oben war die Rede davon, dass sich Das war Pop lesen ließe als Beweisführung darüber, warum die Erzählung vom Sell-out nicht mehr funzt. Wenn wir diese Leseweise nun anwenden, so scheint Divjak deutlich sagen zu wollen: Weil das Reflexionsvermögen im Pop flöten gegangen ist, seit Echtzeit-Kommentare Teil der Popkultur geworden sind. Man mag diese These problematisch finden (Korrelation ungleich Kausation und all das) – mit Verve und formal meisterlich vorgebracht ist sie.
Divjak scheint sich hier vor allem an Testcard-, Spex- und theGap-Lesern zu wenden, um ihnen vorzuschlagen, sich zum Zwecke emanzipatorischer Diskurse doch bitte wieder anderen Kanons und Diskursen zuzuwenden – von Pop jedenfalls sei beim aktuellen Stand der geistigen Produktivkräfte nichts mehr zu erwarten. Welches diese anderen Kanons dann aber wären – welche andere Erzählung an die Stelle der Story vom großen Sell-out treten könnte – ist nicht mehr Gegenstand eines Buches, das da heißt Das war Pop.
Fazit: Divjak erzählt uns in kenntnisreicher, intelligenter Weise und auf der Höhe seines Materials vom Ende dieses Materials. Damit leistet das Buch genau, was es im Titel verspricht. Operation gelungen. Patient tot. Leseempfehlung erteilt.