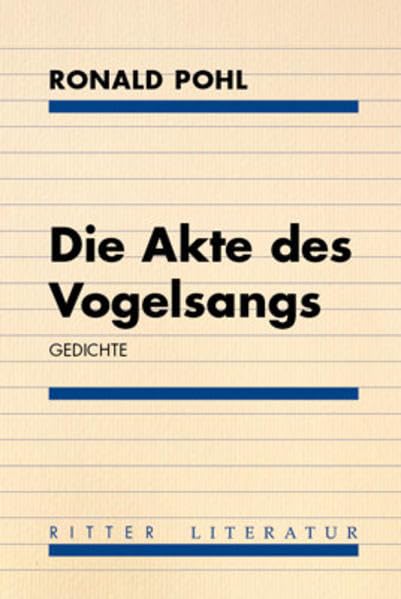Lieder wie Nutzfahrzeuge
Ronald Pohls Gedichte vereinen Moderne, Jazz und Wiener Bühnenschmäh
Ronald Pohls für einen Gedichtband überraschend umfangreiches Buch die akte des vogelsangs gibt sehr viel her, erfordert aber auch viel Arbeit von uns. Das mit der Arbeit liegt nicht an den Motiven und Schauplätzen, die er schildert. Leben in Wien, Vanitas-im-Altersheim, die Adria, die Geschichte des Jazz et al. – Das kennen wir entweder alles aus eigenem Augenschein, oder wir haben zumindest die eine oder andere Idee davon aus zweiter Hand im Hirn rumliegen. Auch, wo es entlegener wird – beispielsweise mit Titeln wie iwanowka 1 oder der spiegel (nach robert creeley) –, sind Topoi, Schauplätze und Personal der Texte zumindest klar bezeichnet und an sich erst einmal kaum rätselhaft – vorausgesetzt, man beherrscht den Umgang mit Google.
Genauso wenig rätselhaft ist, was in den Gedichten mit den genannten Motiven und Schauplätzen passiert. Der Klappentext sagt zu dem, was Pohl tut, „Verzeichnung individueller Erlebnisform“, „tastende Wahrnehmungen“, „Ethos der Improvisation“. Ich würde sagen: Schilderungen oft an der Grenze zur Narration, Extrapolieren von Denkhorizonten aus Details, schließlich dankenswerter Verzicht auf zwangsoriginelles Hintergehen der jeweiligen Gegenstände.
Die viele Arbeit, die der Band uns Lesern macht, rührt also nicht von seinen Inhalten und Verfahrensweisen her. Vielmehr verdankt sie sich dem Verhältnis dieser manifesten Inhalte und Verfahrensweisen zu den literatur-, geistes- und kulturgeschichtlichen Bezügen, die an bzw. in ihnen aufgespannt bzw. festgemacht bzw. aufgehoben sind. Dieses Verhältnis lässt sich so beschreiben: Zuerst vermeinen wir, ein Buch zu lesen, welches uns demonstrieren will, dass „immer noch“ in ganz entschieden hohem Ton – und zwar in einer sehr bestimmten, bruchlos durchgehaltenen Spielart des hohen Tons der klassischen Moderne – über ganz entschieden partikulares, zum Teil subjektives Zeug gedichtet werden kann. Naiv, wie wir sind, lesen wir nun genaue, aber letztlich ebenso naive, in sich ruhende Gedichte über dies und jenes, siehe oben: Altersheim, Adria, Jazzheldensagen. Irgendwann aber kommt uns irgendwas vage bekannt vor, aber eben nur vage, und das lässt uns keine Ruhe; oder irgendeine Wendung wirkt reichlich unvorhergesehen; oder wir werden schlicht vom vorletzten Text – sandbank mit baedeker. nach t. s. eliot – mit der Nase drauf gestoßen, dass unsere naive Lesart noch nicht alles sein kann. Die Eliot-Pastiche ist nämlich der eine Text des Bandes, der naiv nicht funktioniert. Und dann liest man nochmal. Und stellt fest, dass hier alles, aber auch wirklich alles voll mit Metatext ist. Der hat nun seinerseits keine ganz bestimmte „wahre“ Aussage – nach Art einer hermetisch verrätselten Geheimbotschaft hinter dem manifesten Inhalt –, eher gleicht er einem überbordenden, verspielten Fußnotenapparat, der keinen besonderen Grund dafür braucht, dreimal so umfangreich zu sein wie der Haupttext.
Will sagen: die akte des vogelsangs erfordert sehr viel Arbeit, weil der Band darauf hingeschrieben zu sein scheint, dass man ihn liest, wie man die Anfang der Nullerjahre in Mode gekommenen 3D-Bilder betrachtet hat: aktiv und mit doppeltem Fokus. Die Gedichte verhalten sich wie Filme von Quentin Tarantino: Sie setzen sich aus Zitaten, Verweisen und Zitaten von Verweisen auf andere Zitate aus jeweils genau abgegrenzten Regionen der Filmgeschichte zusammen, aber ihre Figuren weisen dabei auch meistens für sich stimmige Motivationen und Charakterisierungen auf.
Text wie Metatext umkreisen dieselben drei Themenkomplexe: die erwähnte klassische Moderne v. a. der englischsprachigen Literatur (Pound, Eliot); den Jazz und (drittens) die verqualmte, zur Geschichtsaufarbeitung nicht fähige Normalität in Nordostösterreich ca. 1970-80. Diesen drei Themenkomplexen entsprechen neben manifesten Tonfällen und Topoi in den Gedichten auch metatextuell gestreifte Weltaneignungsweisen und künstlerische Verlaufsformen: der erwähnte hohe Ton; die Improvisation samt „Synkopen-Trick“ (Zitat Adorno, der das damals abfällig gemeint hatte); das Wiener Kabarett nach Art von Qualtinger und Bronner. Pohl scheint sich, mit anderen Worten, in die akte des vogelsangs indirekt eine Ahnengalerie für seinen eigenen Literaturbegriff zu erschreiben oder auch nur, mutmaßlich, für sein eigenes Lebensgefühl.
Ob es nun für oder gegen den Band spricht, dass er mit all dem Gesagten auf sehr bildungsbürgerliche Weise (nämlich metatextuell) gerade die Geschichte der besseren Alternativen zum alten Bildungsbürgertum (nämlich Moderne, Jazz, Wiener Bühnenschmäh) in den doppelten Fokus setzt, muss der (notwendig bürgerlich gebildete) Leser selbst entscheiden. Eindeutig für das Buch spricht meiner Meinung nach, dass es nicht verstiegen ist, also: dass es auf allen Textebenen und bei aufrechter Formstrenge von erkennbaren Sachen handelt und nicht vielmehr von nichts und wieder nichts; dass es also weder meine Zeit noch meine Aufmerksamkeit verschwendet hat.