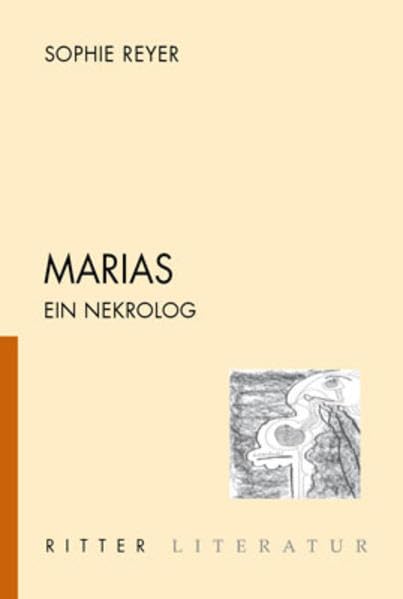Medea und Kolleginnen
Kindesmord von 1787 bis in die Gegenwart
Sophie Reyer kompiliert in ihrer jüngsten literarischen Publikation Marias. Ein Nekrolog verschiedene literarische Quellen, Kataloge und Gutachten von sogenannten Kindsmörderinnen: Dokumente aus Frauen-Dokumentationszentren, Kriminalmuseen, Haftanstalten und der „hohen Literatur“. Reyer entwickelt daraus eine auf mehreren Ebenen arbeitende Prosa, die sprachlich formal konsequent und genau ausgeführt Perspektiven auf Medea und ihre zeitgenössischen Kolleginnen wirft. Nicht zuletzt auch das Medea-Motiv selbst und den Umgang mit diesem kommentiert Reyer auf weiteren Kadenzen in C-Dur.
Klar rhythmisiert und formal requiemartig überarbeitet Reyer die Versuche einer nach Normen strebenden strafenden psychiatrischen Sprachwelt: War Maria kriminell oder doch „nur“ schwach an Verstand und Begriffen? Sind es die ökonomischen Randbedingungen oder die „reine“ Absicht zu töten, wenn Maria die Nabelschnur um den frisch geschlüpften Säugling legt? Ist es der Knecht, der sich weigert, die Leiche als sein eigenes Fleisch und Blut anzuerkennen, oder die staubige Dachkammer, die es einer weiteren Maria trotz allem ermöglichen, dass sie beim Kindsmord geistig und körperlich in einwandfreiem Zustand war?
Die Dokumente decken Identitäten, gesellschaftliche Teilzustände und Verhältnisse exemplarisch vom Jahr 1787 bis zur Gegenwart ab. Aus den Marias, Annas und Theresias werden Katharinas, Monikas und Alices, aus den potentiellen Samenspendern mit Namen wie Johannes oder „Knecht“ werden Ehemänner oder amerikanische Soldaten. Die Motive bleiben dieselben, aber das direkte oder indirekte Mitwirken der Männer an den Morden bleibt meist im Unklaren, selbst wenn die Verhältnisse sich geändert haben oder die Indizien und Motive für die Unschuld der Frauen sprächen. Reyer schreibt „mann“ wenn sie „man“ meint und aber damit „Mann“ meint. Das Changieren zwischen Täter und Opfer wird wiederholt und präzise herausgearbeitet und diskutiert, formal bleibt Reyer dabei stringent und benennt trotzdem Bußgelder namenloser Frauen, Strafgelder in Preußen, Juristenfakultäten und Dienstherren.
Ein Versuch, jenen vielen Frauen Begriffe und Worte zu geben, die „aus ihrer Verzweiflung nirgends hinwussten“ oder andere „institutionelle Probleme“ hatten – Sophie Reyer macht das mit Bravour und lässt dabei auch Goethes Juristerei nicht sprachlos davonkommen. Dass moderne Befruchtungstechniken und Persönlichkeitsrechte von Frauen auch in der Gegenwart wenig vom Charme mittelalterlicher Diskussionen missen lassen, zeigt Reyer unerschrocken und imposant auf: „Big brother is watching big mother“; denn dass Frauen durch ihre Biologie dem Wahnsinn näher stünden als Männer, verstehe sich von selbst. Reyer plädiert für Aufklärung, gegen Faschismus und gibt sich dabei erfrischend kämpferisch und sehr, sehr klar. Wer kein Blut sehen kann und/oder einen empfindlichen Magen hat, sollte dieses Buch nüchtern beginnen.