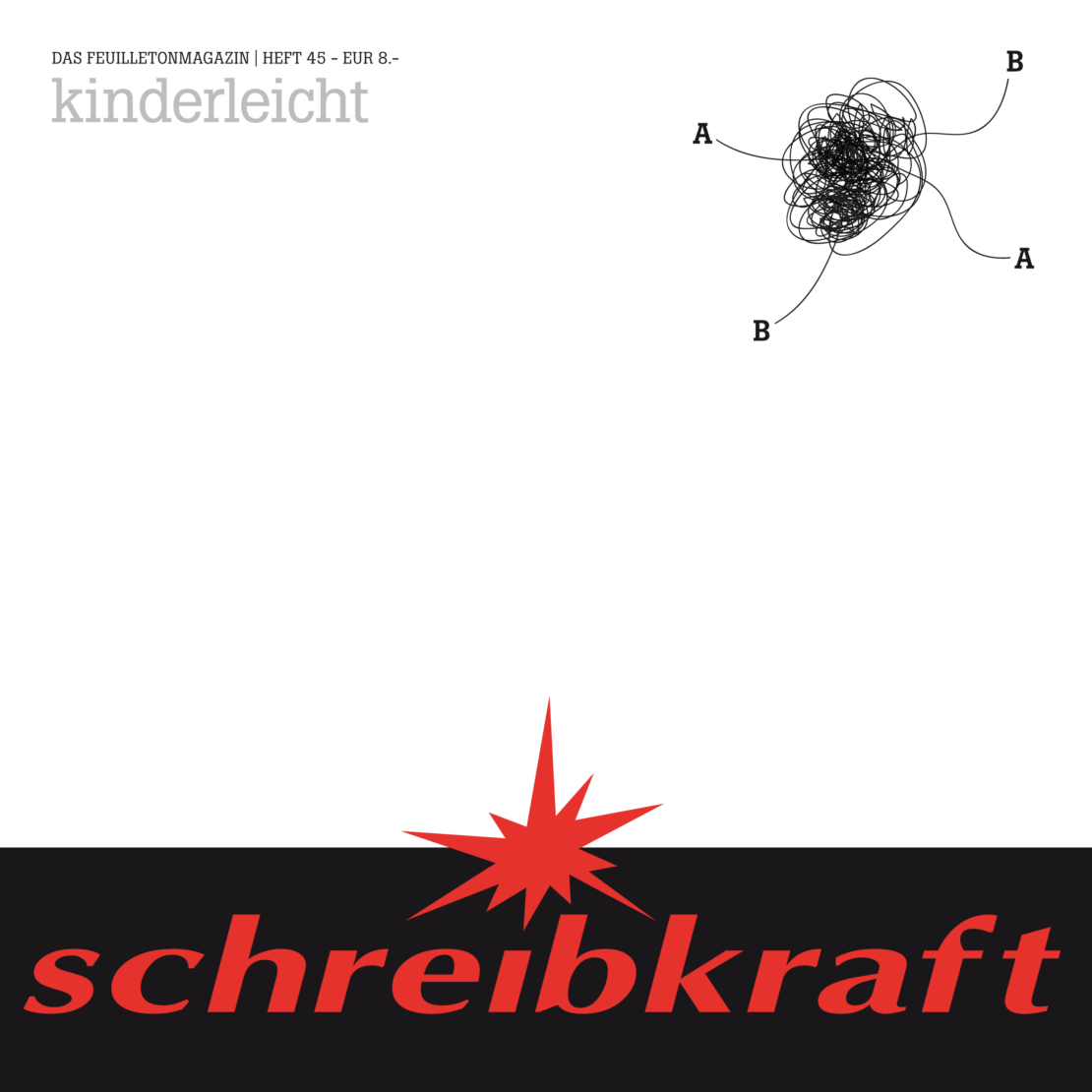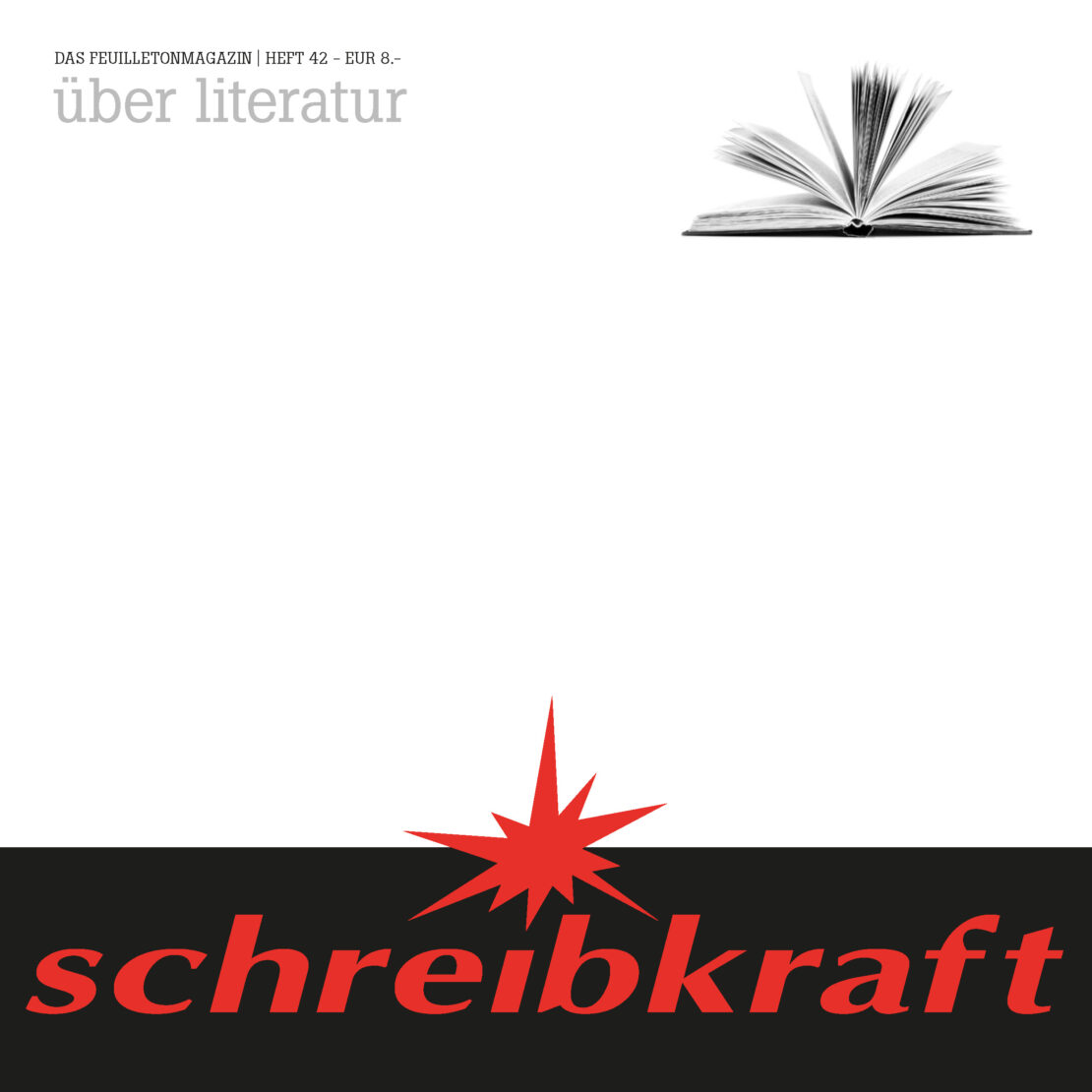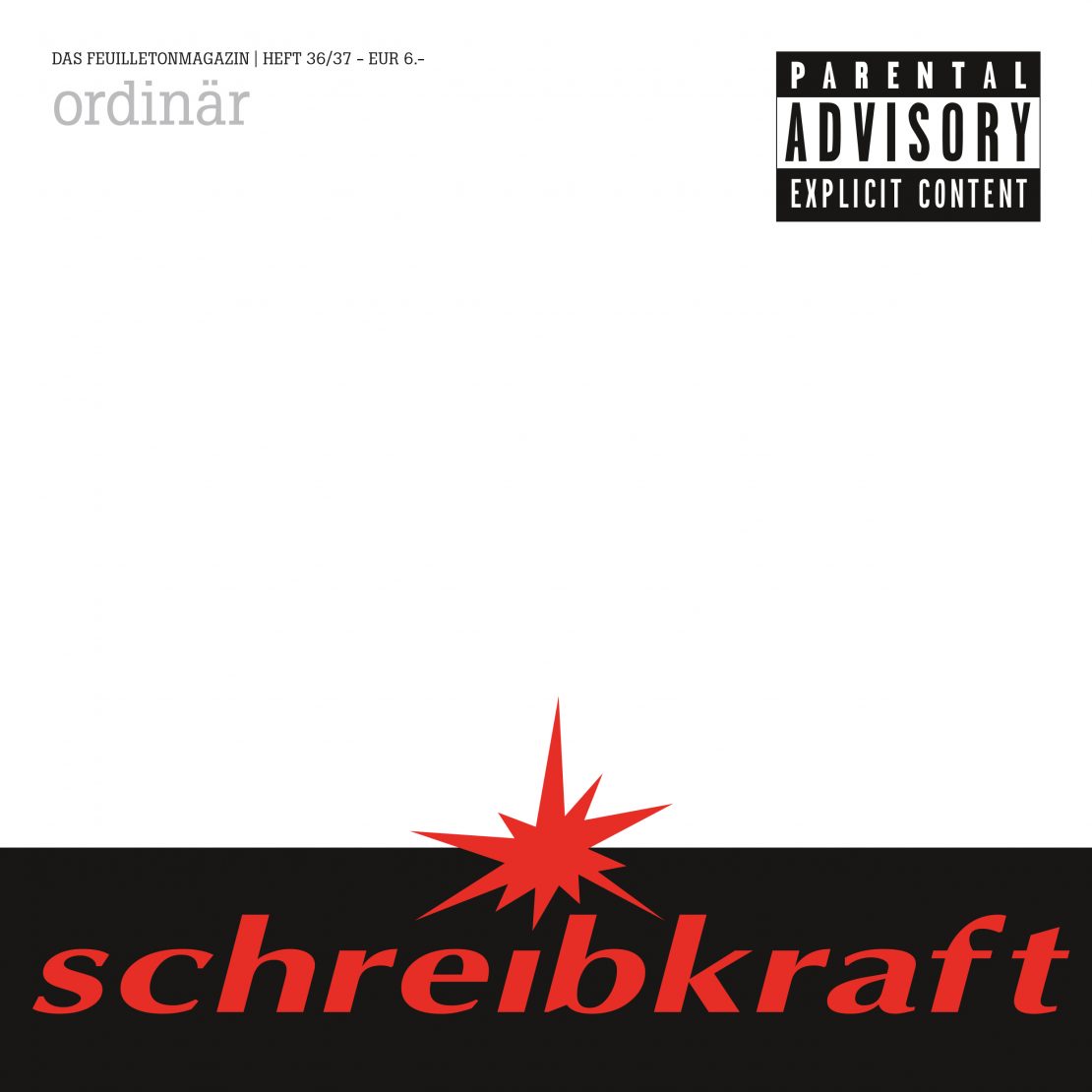Trauen wir uns weiter zu, die Ambivalenzen von Künstler:innen auszuhalten?
In diesem Herbst lief auf Amazon Prime die teuerste jemals produzierte Serie an. „Die Ringe der Macht“ ist der Versuch, aus der Fantasiewelt J. R. R. Tolkiens neu Kapital zu schlagen. „Die Ringe der Macht“ ist auf mehreren Ebenen ausgesprochen interessant, am aufschlussreichsten war aber die schnell aufkeimende Diskussion über die Hautfarbe der Darsteller:innen. Ob Menschen, Elben, Zwerge oder Ur-Hobbits, die Produzent:innen der Serie hatten sich dazu entschlossen, Menschen und Fantasiewesen ein diverses Aussehen zu verleihen. Die Diskussion, ob es so etwas wie „schwarze Elben“ geben könne, ist angesichts des Fantasy-Charakters des Stoffs naturgemäß bizarr. Aber sie weist den Weg zu etwas Wesentlichem: Die Frage nach dem Charakter der Erfindung. Tolkiens Mittelerde-Konstrukt ist latent rassistisch. Das Werk ist verfasst worden, während die Welt in große, antagonistische Einflussbereiche geteilt war. Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit waren der gesellschaftliche Horizont, in dem Tolkiens Hell-dunkel-Konzept Gestalt angenommen hat. Das könnte eine der Ursachen für den rassistischen, kolonialen Grundton der Schwarz-Weiß-Moral Tolkiens sein. Elben und Menschen sind darin eher nordisch, die Orks und ihre Helfer aus dem Süden dagegen eindeutig keine Europäer. Die „Herr der Ringe“-Welt weckt über die Feinde der Helden sowohl Assoziationen an die Unheimlichkeit der weiten Landmassen Sibiriens als auch an den globalen Süden. Peter Jacksons Verfilmung enthält diesen geopolitischen Wahn noch. 20 Jahre später scheint es nicht mehr möglich, diesen abzubilden. Mit der Entscheidung, schwarze Hobbits und Elben einzuführen, hat man diesen verstörenden Aspekt des Werks entsorgt, es wurde sozusagen bereinigt.
Die Vollversion des Textes finden Sie im Heft