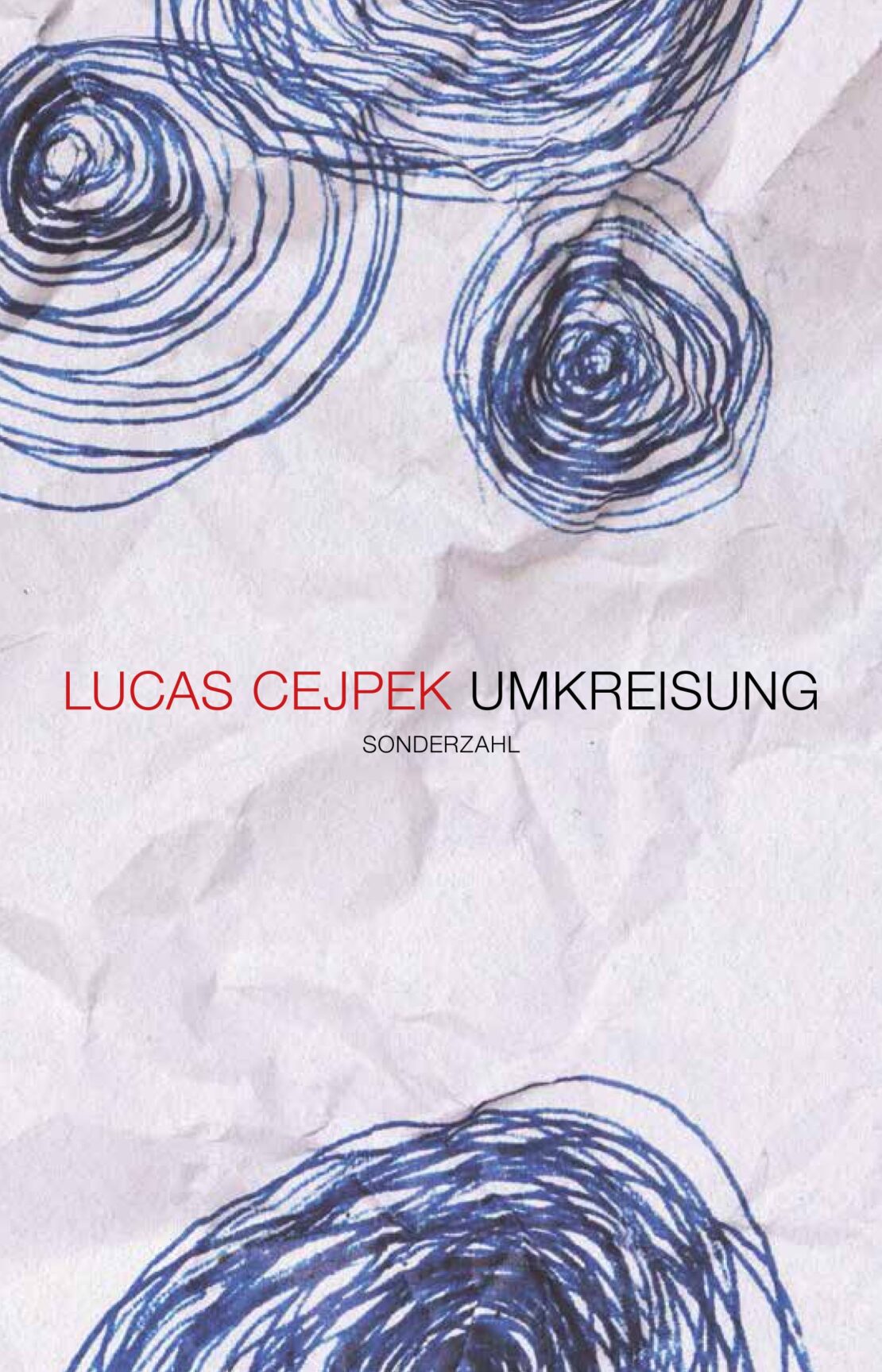Die Unmöglichkeit von Zufall
In Lukas Cejpeks „Umkreisungen“ taktet der Schritt das Denken und offenbart einen Charakter.
In einer Zeit, in der das Wichtigste an Literatur oft zu sein scheint, in welche Schublade sie zu stecken ist, ob wir mit ihr also einen Roman, einen Gedichtband oder einen Essay vor uns haben, beweist „Umkreisung“ von Lukas Cejpek, dass die Menschheit doch imstande wäre, über diese jämmerlichen Besteckschubladen hinauszudenken, andere Werkzeuge zu erfinden und eben auch Texte, die ganz andere Wege einschlagen. Vielleicht gibt es Hoffnung, dass Menschen nicht nur in diesem Bereich die ausgetretenen Pfade zu verlassen und neue Gangarten zu erfinden vermöchten. Ja, es geht hier ums Gehen, und das Ich in „Umkreisung“ könnte auf den ersten Blick als der klassische Flaneur eingeordnet werden, doch fehlen ihm dankenswerterweise jegliche Überheblichkeit und jegliches Dandytum. Dieses Ich folgt einer Frau, doch lässt schon ihr Name das Konzept des Textes durchschimmern: Die beobachtende, berichtende Person nennt sie „Iris“, und der Blick auf sie ist es, der noch im ersten Satz von ihr wegführt, nämlich zum Wiener Petersplatz, zur Geschichte der ersten Kirche Wiens, und da ist die Frau auch schon verschwunden, und der Erzähler weiß selbst nicht, ob sie in einem Restaurant oder einer Passage verschwunden ist. Mit der von Walter Benjamin strapazierten „Passage“ aber haben wir das Stichwort: Diese – das Durchgehen – eröffnet unzählige neue Möglichkeiten des Fortführens eines feinen Ariadnefadens. Adolf Loos hat sinngemäß einmal von der Attraktivität von Gebäuden gesprochen, die immer wieder neue Einblicke und Durchblicke ermöglichen, und das schafft dieser Text. Wie bei Marcel Proust bleibt der Blick des Schweifenden an einem Detail hängen, doch fädelt er nicht etwa nur Blitzlichter auf Architektonisches auf, sondern vor allem eine Unmenge an Überlegungen zu Kunst und Literatur, zur Erinnerung und zum Sehen, zur Geschichte und zu den Wissenschaften. Der Text wirkt zuweilen, als würde er beim Surfen im Internet vom Hundertsten ins Tausendste kommen, das allerdings in einer analogen Form des Googelns, als wäre eine Bewegung, die einmal in der Literatur eine herausragende Rolle spielte, dann banalisiert ins Internet verschwand, ganz neu wieder in den realen Raum zurückgekehrt. Gleichzeitig ist er eben „Umkreisung“: All die Überlegungen und Informationen, die sonst meistens außerhalb des Textes bleiben, sind die Meilensteine seiner Bewegung. Und so ist er gleichzeitig sowohl die Reflexion seines Fortschreitens als auch dieses selbst. Zitate bilden ihn und umkreisen ihn theoretisch. Die Frage nach Form und Inhalt wird neu gestellt. Und: Wie halten unsere verschiedenen Bewusstseinsfetzchen zusammen? Wie konstituieren wir uns mit allen Ebenen unseres Wissens, Beobachtens, Neu-Organisierens? Vielleicht ist „Umkreisung“ ein Versuch über die Unmöglichkeit von Zufälligkeit. Alles ordnet sich letztlich ein in diesen Zusammenhang des Bewusstseins, es gibt nichts, was darin keinen Platz finden könnte, außer vielleicht, man vergäße die Neugier aufs Leben, verfiele der Melancholie, die Dürer als einen unerforschlichen Klotz in der Landschaft darstellt. Hier ist ein agiler Geist zu entdecken, dessen physisches Gehen immer auch ein Gehen des Geistes ist. Der Schritt taktet das Denken und offenbart – ganz anders jedoch als in Thomas Bernhards „Gehen“ – einen Charakter. So wird der Text zum „Self-Portrait in a Convex Mirror“, wie John Ashbery Parmigianinos Bild seiner zeichnenden Hand genannt hat, zum Bild einer Person, die die Welt mit allem, mit dem sie ihr begegnet, in sich vereint.
Das Buch ist hier erhältlich.