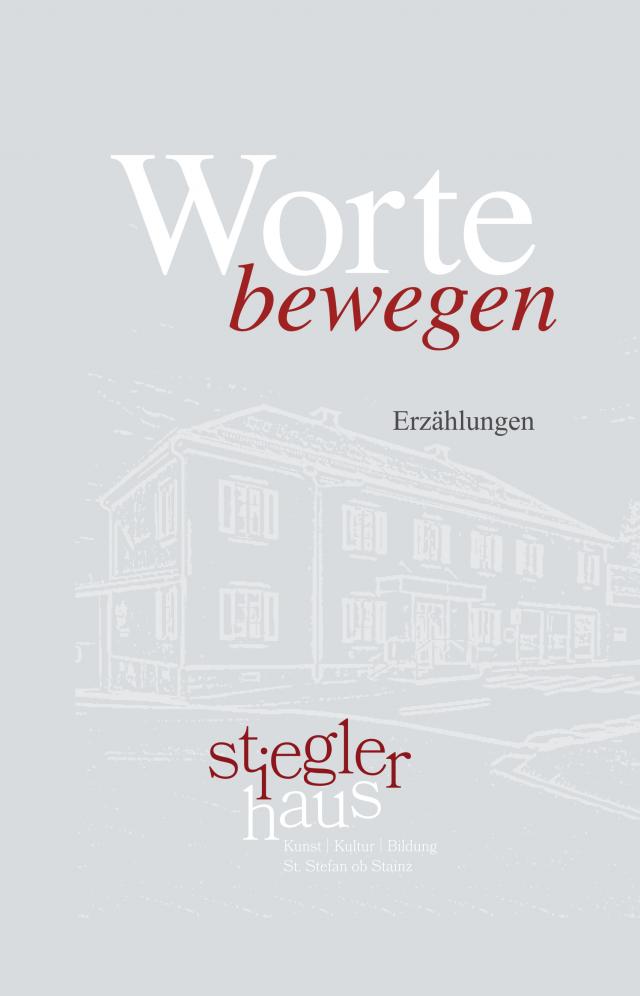Erinnerungen festhalten
Der Sammelband „Worte bewegen“ versammelt Texte von leidenschaftlicher Aktualität.
Mit „Worte bewegen“ initiierte das Stieglerhaus ein neues Projekt und vergab im Zuge des gleichnamigen Literaturfestivals zum ersten Mal den Österreichischen Literaturpreis für Erzählungen. Aus den über 300 Texteinreichungen wurden neun Texte ausgewählt, die nunmehr in der Anthologie selben Namens veröffentlicht wurden. Die Themenbereiche der ausgewählten Texte sind vor allem eines: vielfältig. Von persönlichen Lebenskrisen, die in der Gegenwart stattfinden, über die Aufarbeitung der Beziehung zum Vater mit Hilfe von Fotoalben bis hin zu einem erotischen Friseurbesuch kann in diesem kleinen Büchlein vieles gefunden werden. So unscheinbar und zurückhaltend das Buchcover auch sein mag, der Inhalt ist weder schüchtern noch prüde, sondern zeichnet sich durch leidenschaftliche Aktualität aus.
Begonnen wird mit einer Erzählung, deren Ausgang die Leserinnen und Leser im Unklaren lässt. Eine Familie bezieht gezwungenermaßen ein neues Haus, sie erhält keinen Schlüssel und ihr Grundstück ist umzäunt. Auf direkte Reden wird bis zum Ende der Geschichte verzichtet, was ein beklemmendes Gefühl erzeugt. Der erste Satz der Protagonistin: „Wir sind in Sicherheit, wir sind hier sicher“, löst dieses Gefühl letztendlich auf und ersetzt es durch Erleichterung. Die Autorin Claudia Bitter zeigt mit ihrer Geschichte, wie wichtig das Empfinden von Sicherheit und Privatsphäre ist.
Das wohl gegenwärtigste Thema, das in der Anthologie behandelt wird, ist die Situation der Coronakrise. Die neue, erzwungene Nähe zu Personen, mit der wir plötzlich konfrontiert sind, wird im Text von Ulrike Haidacher durch eine unübliche WG-Konstellation dargestellt. Die Ich-Erzählerin lernt das Paar, mit dem sie seit längerer Zeit zusammenlebt, auf einer bislang unbekannten Ebene kennen. Es stellt sich heraus, dass die jungen Eheleute einem veralteten Rollenbild und einer ‚traditionsbewussten‘ Heimatideologie nachhängen, diese aber selbst verklärt wahrnehmen als moderne, berechtigte Auslegung des Ewig-Gestrigen, als ob das, was immer schon war gerade weil es immer schon war auch schon Berechtigung hätte.
In mehreren der Erzählungen werden Einsamkeit und Drogenabhängigkeit thematisiert. Dabei fand die Umsetzung der Themen auf völlig unterschiedliche Art und Weise statt. In Martin Peichls Text versucht sich seine Figur durch das Betrachten von Fotoalben dem verstorbenen Vater anzunähern. Der Vater der Erzählfigur ist aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit ums Leben gekommen. Er scheint in den Gedanken des Protagonisten jedoch immer noch allgegenwärtig zu sein, welcher paradoxerweise versucht, seine Trauer mit Hilfe von Alkohol zu betäuben. Alkohol – das allgemeine Verdrängungsmittel der österreichischen Gesellschaft – ersetzt für viele anfänglich Trauer und Auseinandersetzung. Die Paradoxie der ganzen Geschichte zeigt sich auch in der Tatsache, dass sich die Verbliebenen nach der Beisetzung des alkoholkranken Vaters im Wirtshaus unmittelbar selbst betrinken. Die Erzählung von Felicia Schätzer Niemand ist niemandem nah beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Drogen, jedoch auf eine völlig andere Weise. Die Hauptfigur der Geschichte versucht mit Hilfe von Drogen neue Menschen kennenzulernen und dadurch ihre Einsamkeit zu überbrücken. Schätzer gelingt es dabei sehr gut, die Gefühlskälte, die uns im Alltag oftmals begegnet, darzustellen. Wir leben in einer Welt, in der dem Einzelnen wenig Bedeutung zukommt. Es wirkt zwar, als würden wir alle als freie Individuen existieren, in Wirklichkeit jedoch wird von uns ein großes Mas an Anpassung verlangt. Gibt es dann doch Ausreißer, heutzutage gerne auch als ‚Systemsprenger‘ bezeichnet, wird deren Individualität nicht unterstützt, sondern es wird versucht, sie an das normierende System anzupassen – mitunter sogar durch geliebte Menschen wie die eigenen Eltern. Dieses Hineinpressen in ein System führt dazu, dass das Handeln des Einzelnen distanziert und bedeutungslos wird, es erhält etwas Roboterhaftes, dem jeder Funke Einzigartigkeit ausgetrieben wird. Wir definieren uns zu sehr über Erwartungen anderer und am Ende bleibt nur noch die Einsamkeit.
Die Anthologie „Worte bewegen“ enthält jedoch nicht nur in der Gegenwart angesiedelte Erzählungen. Wilhelm Kuehs erzählt etwa eine Geschichte, in der er tragische und berührende Erinnerungen festhält. Er versucht Schicksale von Kindern aus Serbien, die das Konzentrationslager Jasenovac überlebten, festzuhalten. Dabei verweist der Autor immer wieder auf die Wichtigkeit des Niederschreibens von Geschichten, um sie für die Nachwelt festzuhalten damit sie nicht im Schweigen ersticken. Auch in Elisabeth Schmidauers Erzählung spielen wie schon bei Martin Peichls Text Fotoalben eine zentrale Rolle. Die Geschichte erzählt ebenfalls von einem Vater, von Massentötungen und von der verdrängten Schuld, die zurückbleibt. Der Vater versucht, sein Handeln zu rechtfertigen, indem er immer wieder darauf verweist, dass er die Tötungen ausschließlich zum Wohl seiner Nachkommen durchgeführt habe. Schmidauers Erzählungen sind sehr bildhaft und lassen jede einzelne der tragischen Szenen vor dem inneren Auge aufscheinen. Durch die unerschütterliche Meinung des Vaters, nichts Verwerfliches getan zu haben, zeigt sich die Angst davor, das Leben nicht sinnhaft verbracht zu haben. Außerdem wird die Furcht vor der Konfrontation mit der Vergangenheit sichtbar.
Summa summarum ist zu konstatieren, dass alle Erzählungen des Bandes tatsächlich ungemein bewegen und dass in den 128 Seiten des schmalen Bandes erstaunlich viel Leben und Emotion stecken.
Das Buch ist hier erhältlich.