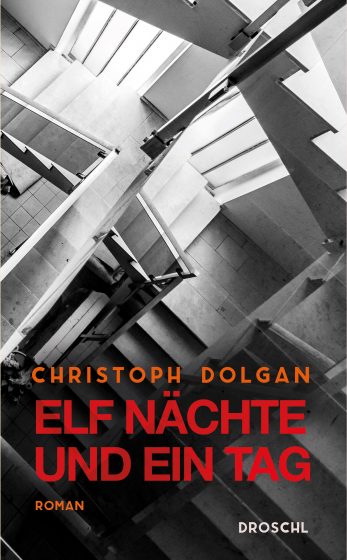AUFGEZWUNGENE STARRE
In Elf Nächte und ein Tag zeichnet Christoph Dolgan ein dicht gewobenes Psychogramm einer bedrückenden Freundschaft.
Das heftigste Kapitel ist jenes, wo die Hauptfiguren Theodor und der Ich-Erzähler sich das Vertrauen eines Obdachlosen namens Jakob erschleichen. Jakob hat sich unter einer Brücke ein Kabuff erschaffen, wo er seine einzigen verbliebenen Habseligkeiten –
darunter eine alte Wanduhr und einen Thermoschlafsack – hortet und hütet wie seinen Augapfel. Als Jakob mal nicht am Platz ist, zerbrechen Theodor und der Ich-Erzähler die Wanduhr und bringen seine Hütte durcheinander, nur um später die Überraschten
zu mimen, als Jakob ihnen von dieser Heimsuchung erzählt. Aber dabei bleibt es nicht: Die beiden Sadisten tränken den Schlafsack des Obdachlosen in Urin, und als sie später auch
noch seinen Bretterverschlag abfackeln, ist das endgültig zu viel für den Obdachlosen: Jakob nimmt sich das Leben.
In seiner Grausamkeit fällt dieses Kapitel aus dem Rahmen von Christoph Dolgans neuem Roman Elf Nächte und ein Tag. Denn es erinnert eher an Anthony Burgess‘ A Clockwork
Orange, während die Elf Nächte Buch immer wieder auftauchen und das Manische bzw. das Depressive symbolisieren, die das kurze Leben der Hauptfigur Theodor beherrschen.
Theodor hat sich eines Tages umgebracht, aber in den Gedanken und Erinnerungen des Ich-Erzählers ist der Freund noch lebendig, selbst zwei Jahre nach Theodors Selbstmord:
Der Erzähler erinnert sich in elf Kapiteln, die jeweils in Nachtstunden spielen, an gemeinsame Erlebnisse und gemeinsame Freunde. Etwa an den „Ingenieur“, einen Fotokünstler, der in einem Abbruchhaus Quartier bezogen hat. Oder an die verlorenen
Gestalten in Theodors Lieblingsbar „Eule“, wo der Schnaps in Flaschen auf den Tisch gestellt und der Preis nach konsumierten Zentimetern Flaschenpegel berechnet wird.
Der Ich-Erzähler fiebert sich durch die elf Nächte, um die Erinnerung an Theodor abzuschütteln. „Stärker als zu Lebzeiten stand er mir im Weg, seine Gegenwart zwang mir eine Starre auf, ein Dahinvegetieren, das ich satthatte.“ Dabei dreht der Erzähler als Nachtwächter seine Runden durch ein Universitäts-Gebäude, wo er bei Regenwetter manchmal das obdachlose Paar Lisa und Andrei übernachten lässt. Und er erinnert sich immer wieder an Theodors Besessenheit von insgesamt einem somnambulen Album
von The Cure ähneln. Die Assoziation mit A Clockwork Orange hat aber insofern ihre Berechtigung, als die Farben Orange und Blau in Dolgans Dostojewski-Romanen und -Erzählungen.
„Zu unseren wenigen Begegnungen brachte er immer ein Buch mit, das ich unbedingt lesen muss: Ich bräuchte sonst nichts, jede andere Lektüre sei wertlos, alles stünde schon bei Dostojewski.“ Ist der Roman am Ende eine moderne Version des frühen Dostojewski-Textes Der Doppelgänger, wo die Hauptfigur von einem Doppelgänger aus Amt und Würden verdrängt wird? Immerhin hat sich der Ich-Erzähler nach dessen Ableben in Theodors Wohnung eingerichtet. Und er ist auch drauf und dran, Theodors Vorhaben
einzulösen, einmal nach St. Petersburg zu fahren: „Es ist eine Stadt von Halbverrückten. Selten findet man so viele finstere, tief einschneidende und eigentümliche Einflüsse auf die Seele vor wie in Sankt Petersburg.“
Christoph Dolgans Ich-Erzähler beschreibt die Begegnungen und die Gegenstände und Vorgänge um ihn herum mit großer Klarheit, und gleichzeitig hat man immer den Eindruck, das Wichtigste bleibe im Dunkeln. Die große Stärke des bedrückenden und anspielungsreichen Buches ist es, Dinge offenzulassen. Am Ende sehen wir den Ich-Erzähler mit leichtem Gepäck und einem Ticket nach Russland auf dem Bahnsteig sitzen. Ob er in den Zug einsteigen wird, ist ungewiss. Und noch ungewisser bleibt, ob er in diesem St. Petersburg irgendetwas finden könnte, was er nicht in den Nächten in seiner mitteleuropäischen Heimatstadt längst schon umkreist und entdeckt hat an geheimnisvollen Verbindungen zwischen sich und seiner sinisteren und ungreifbaren Welt.