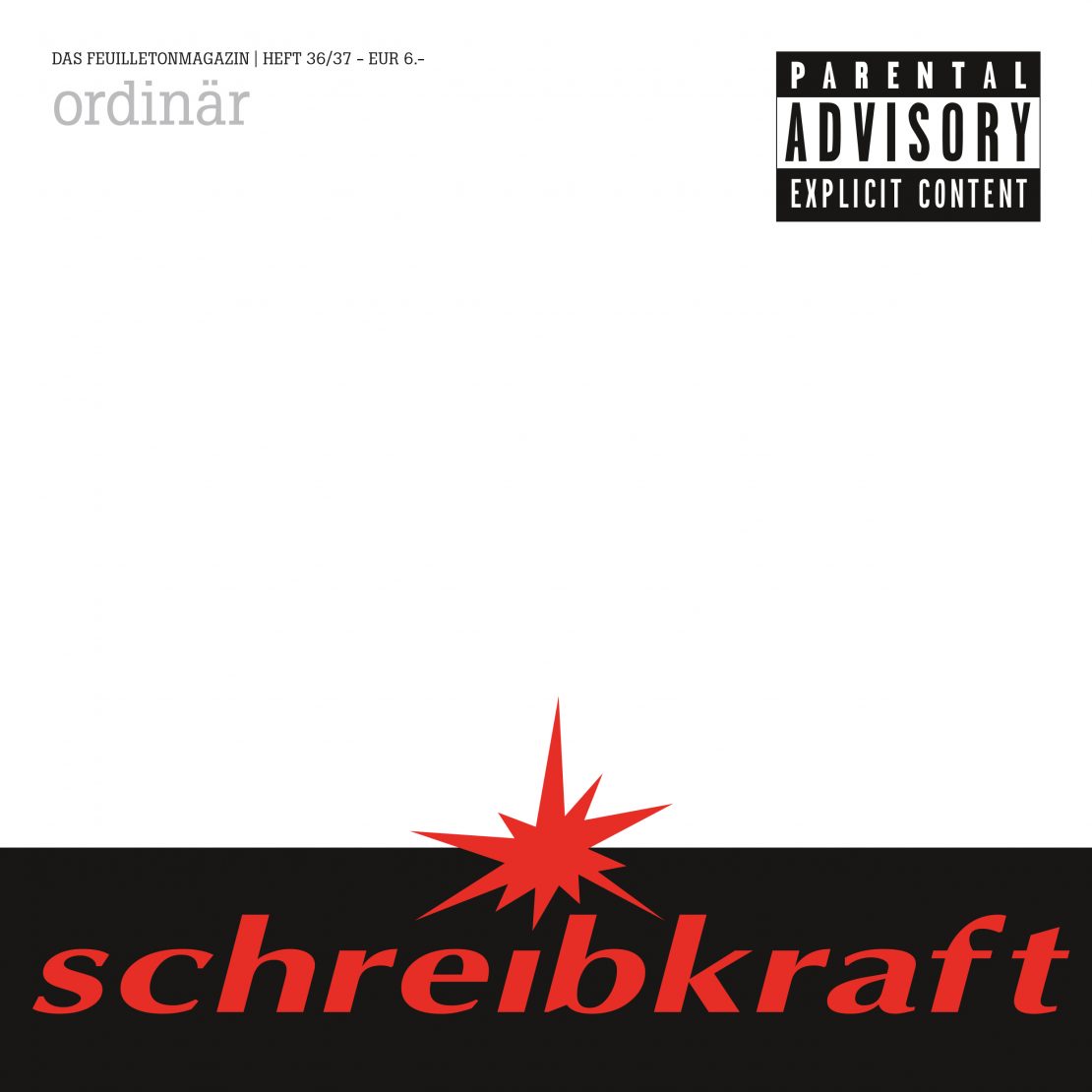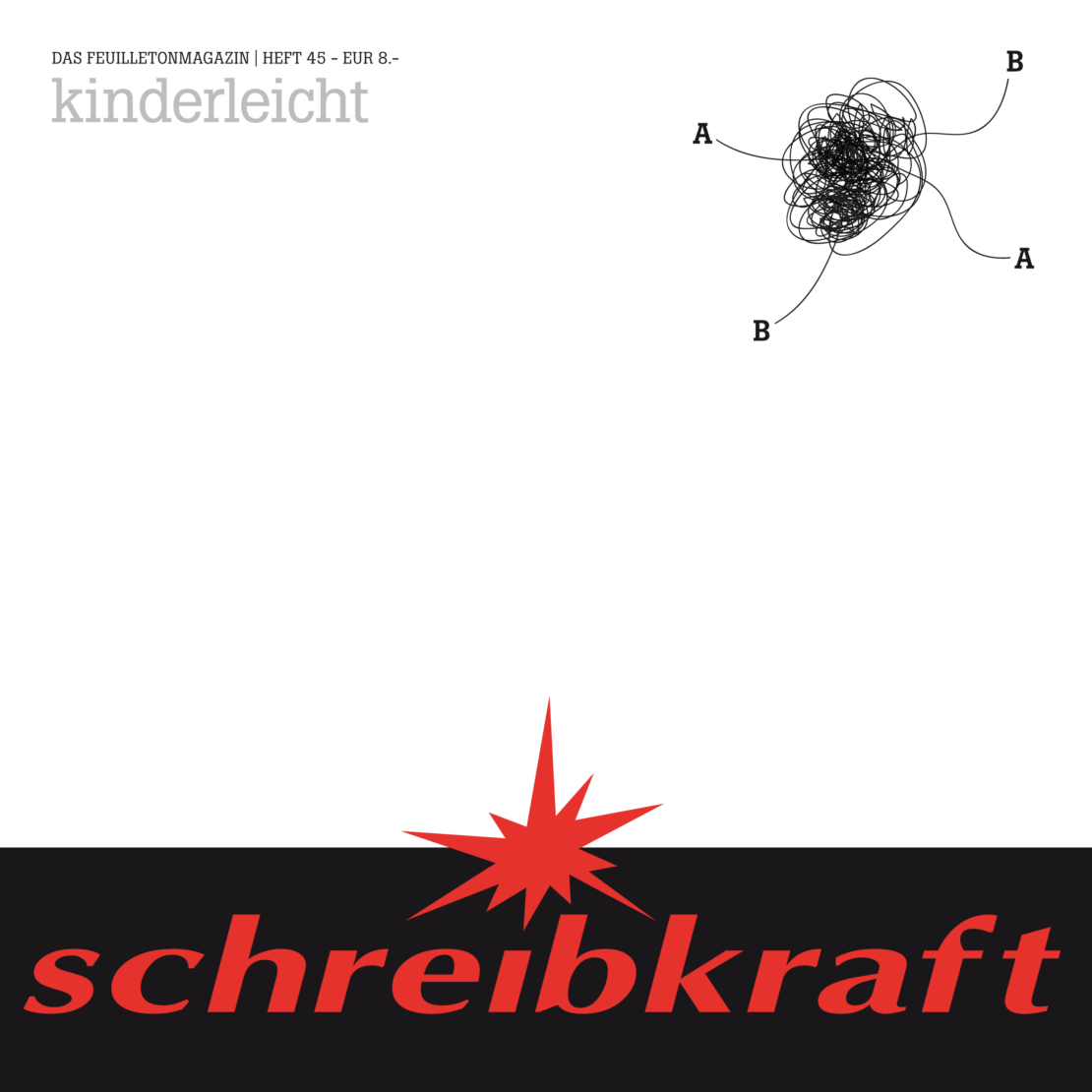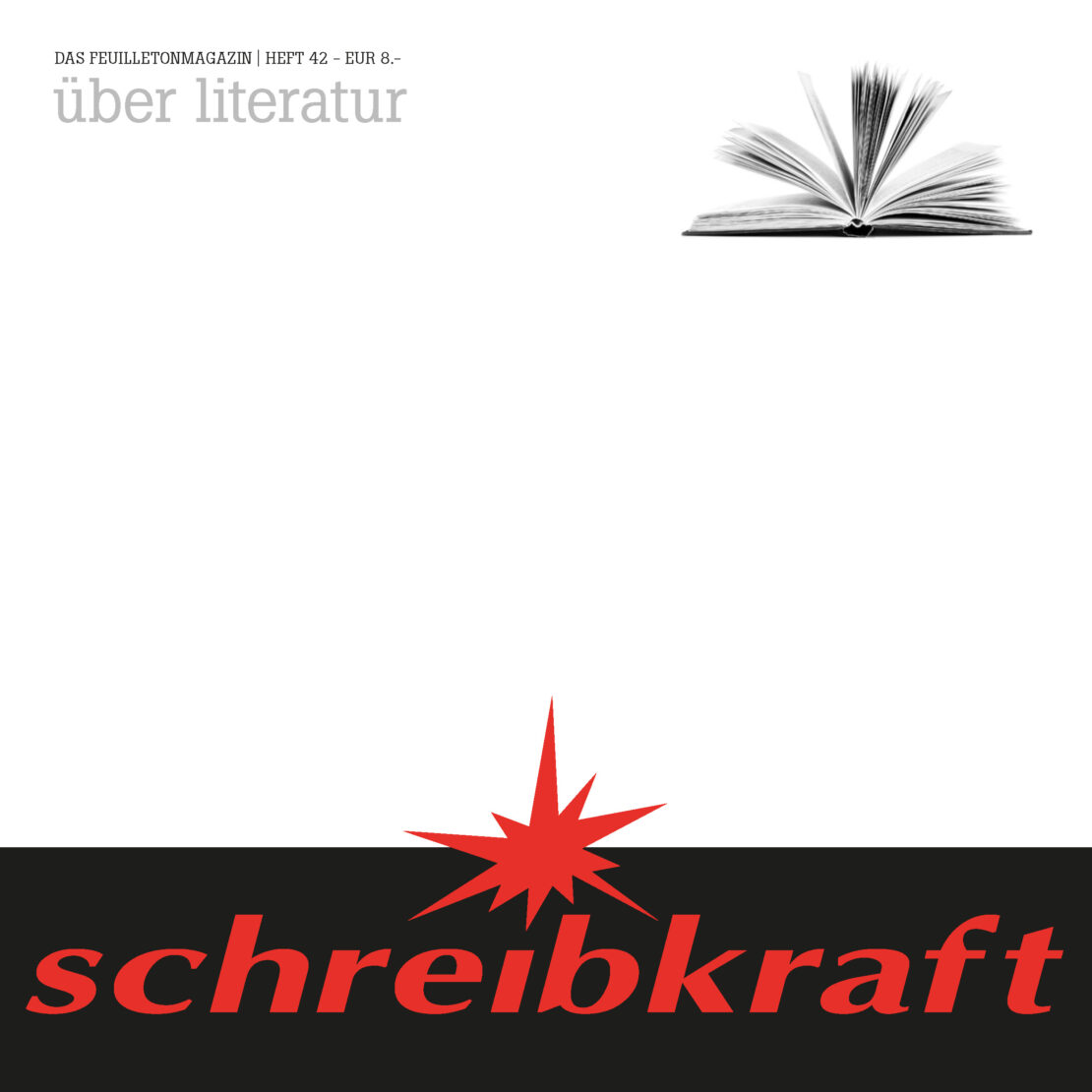Das verlorene Normale wird zur verblassenden Erinnerung. Das ist der normale Lauf der Welt.
Meine Mutter war Anfang 1946 eine Flüchtlingsfrau aus der Batschka, das ist eine deutschsprachige Gegend im ehemaligen Jugoslawien nahe der Grenze zu Ungarn. Meine Großmutter, die mit uns zusammen vor den Partisanen nach Deutschland geflohen war, war stolz darauf, noch während der K.-u.-k.-Monarchie in Ungarn geboren zu sein. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg und später immer wieder, denn dieser ungarische grenznahe Ort wurde mal diesem, mal jenem Land zugeschlagen.
Ich wuchs mit dem Wort „ordinär“ auf, denn meine Mutter und meine Großmutter benutzten es häufig, um etwas Negatives auszudrücken. Der Tonfall, in dem das Wort ausgesprochen wurde, sagte eigentlich schon alles. Meine Mutter verabscheute ordinäres Gehabe, ordinäre Sprache, ordinäre Kleidung. Sie wusste, was sie damit meinte, denn sie kannte ja schon den Unterschied zwischen „gewöhnlich“ und „außergewöhnlich“ oder zwischen „normal“ und „unnormal“. Ich aber war ein Kind unter Kindern, wollte sein wie alle anderen und was ich sein wollte, das war das Normale, das in alten Zeiten als ordinär bezeichnet wurde, jedoch ohne moralische Abwertung. Es bezeichnete den Normalzustand, den Normalbürger, den man in Frankreich „citoyen ordinaire“ nennt. Ein solcher Normalbürger will doch jeder kleine Erstklässler sein, insbesondere dann, wenn, wie in meinem Falle, die Umstände dafür gesorgt hatten, dass ich, das Flüchtlingskind, mich schon dadurch von den anderen unterschied, dass ich nicht hier geboren war. Ich gehörte nicht zu den Einheimischen, meine Mutter, Großmutter und meine Schwester auch nicht, auch nicht mein Vater, der irgendwo in Gefangenschaft war. Schon allein dass ich einen anderen Dialekt und gelegentlich etwas Kroatisch sprach, hätte genügt, um mich vom Normalen, dem Ordinären, zu unterscheiden.
mehr im Heft