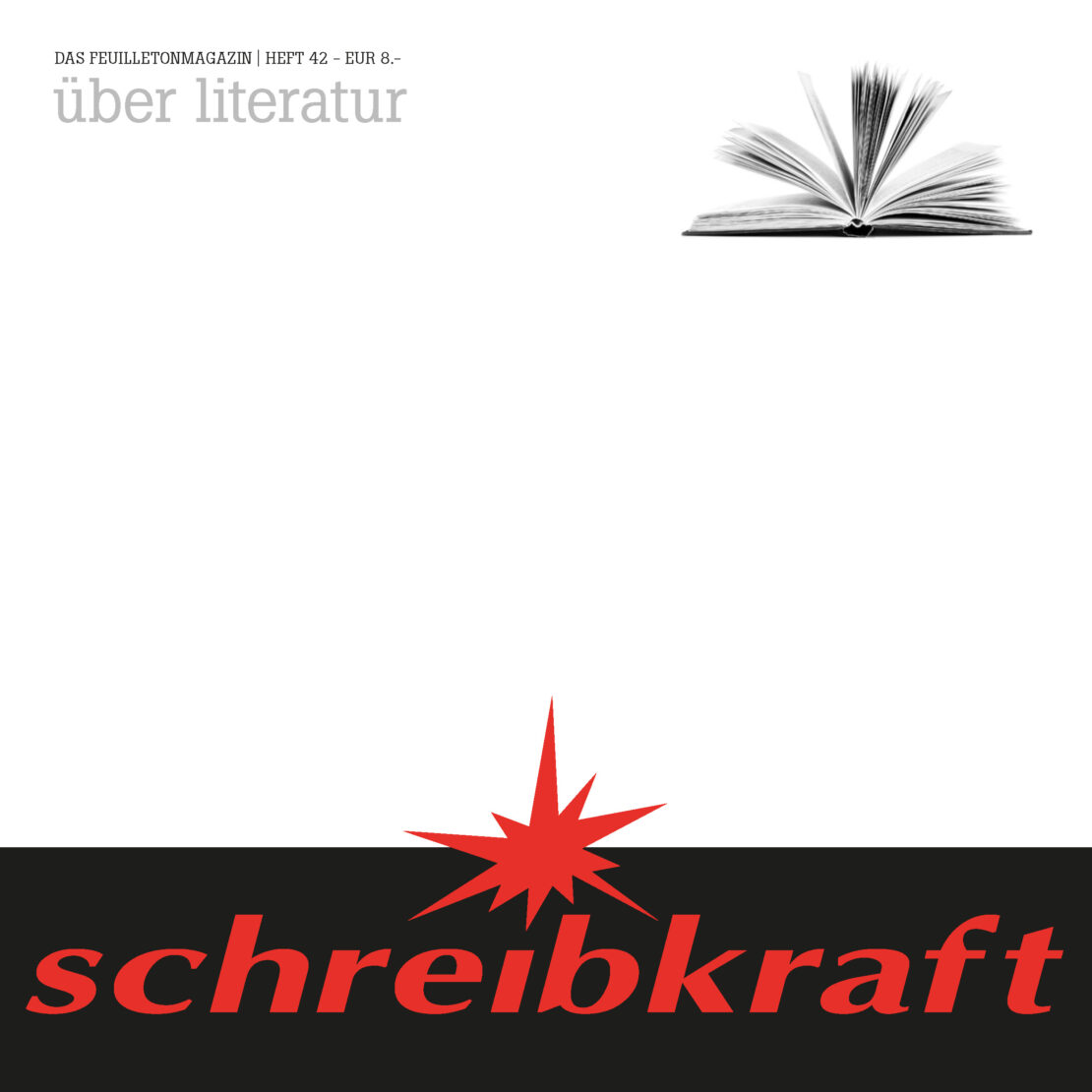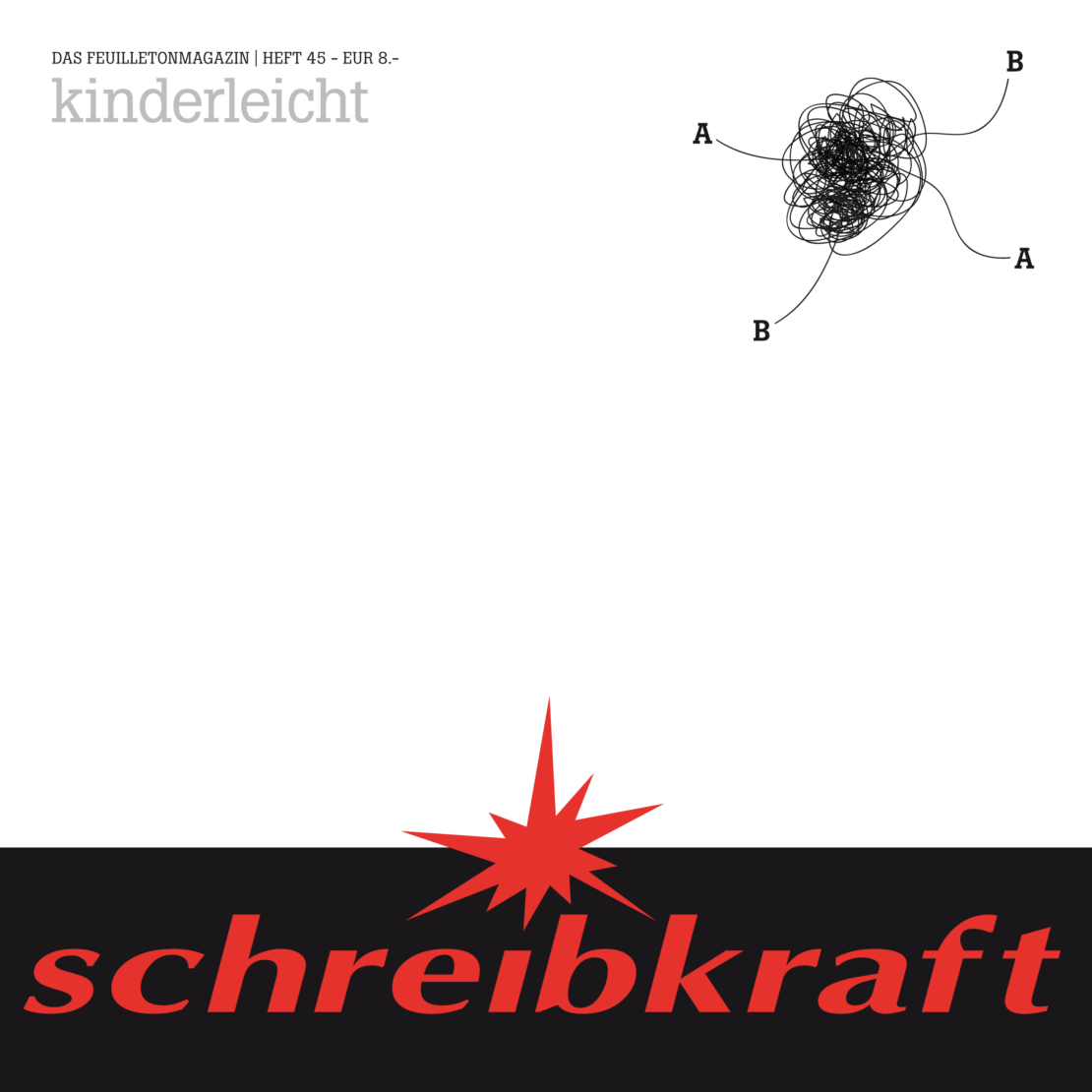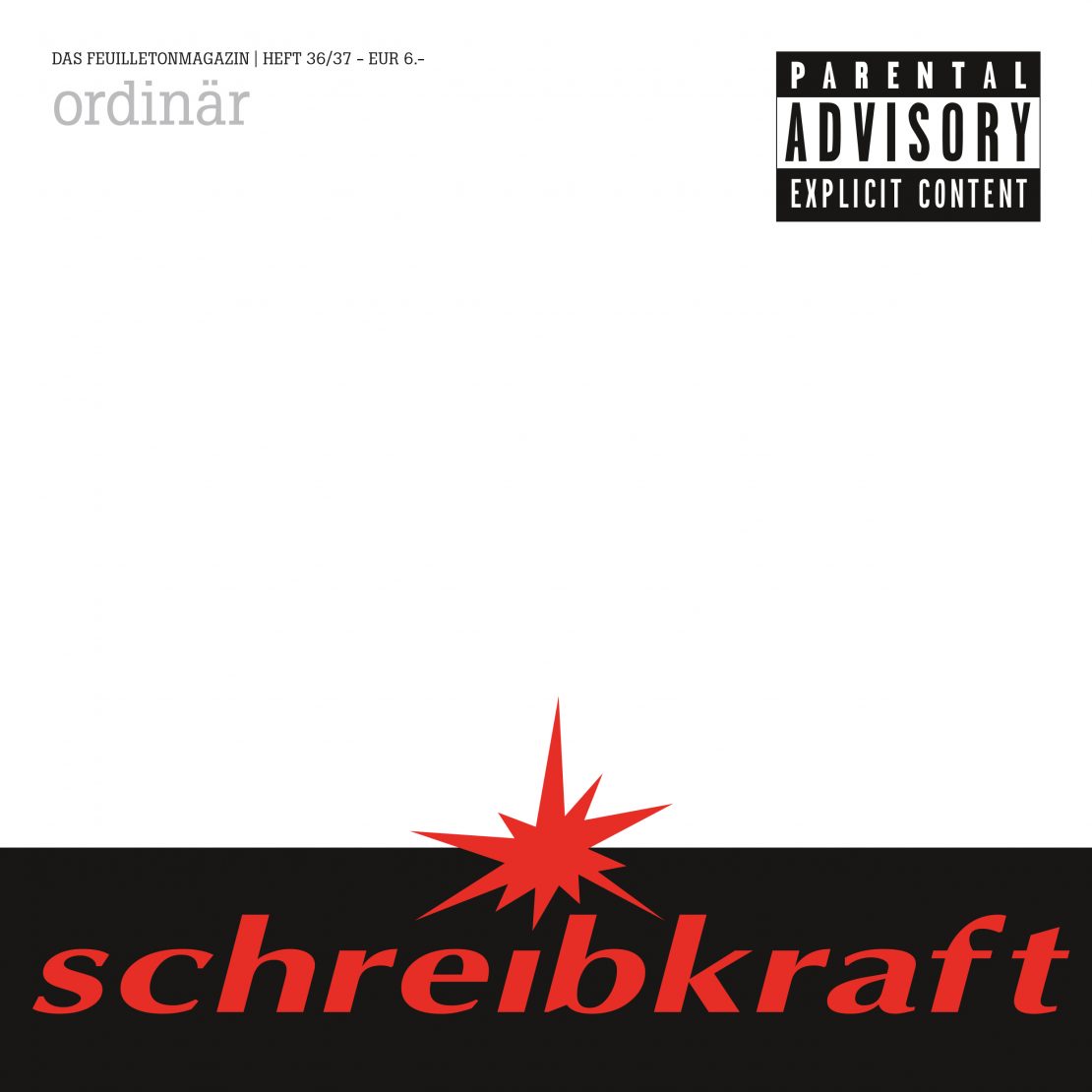Was, wenn Roland Barthes Unrecht hatte.
Ich war drei Jahre alt, als ein berühmter und heute berüchtigter Essay von Roland Barthes erschien. In diesem Alter fing ich an, mir Dinge vorzustellen, die gar nicht da waren. Ich war der Autor einer Welt. Es dauerte weitere 25 Jahre, bis ich selbst mit diesem Essay konfrontiert wurde. Ich hatte mein allererstes Gedicht veröffentlicht, da erfuhr ich von Roland Barthes, dass ich, der Autorgott, tot bin. Dieses Gedicht war nicht von mir. Es war „ein Gewebe aus Zitaten aus den tausend Brennpunkten der Kultur“. Mein mir so vertrautes Gehirn fertigte dieses Gedicht im Hintergrund als ein Sprachmuster-Generator, den auch eine gut programmierte Software hätte produzieren können. Ich, der Autorgott dieses Gedichtes, hatte mich im toxischen Gewebe der Zitate aufgelöst wie in kultureller Salzsäure und existierte nur noch im zukünftigen Leser. „Der Tod des Autors“ war eine Grundformel der Postmoderne. Es waren die 1990er und ich verstand mich selbst als postmodern. Vernunft und Wahrheitsfindung betrachtete ich skeptisch und mich selbst als autonomes Subjekt zu betrachten als lächerlich. Ich befand mich in einem zeichenreichen Zeichenreich und alles, was ich betrachtete oder was mir widerfuhr, war zeichenhaft. Dennoch, bei aller Postmodernität, Zeichenhaftigkeit und Ich-Distanz bezog ich Becketts Ausspruch „Wen kümmert‘s, wer spricht“ nicht auf mich und mein erstes gedrucktes, in einem Buch veröffentlichtes Gedicht. Das waren ich und mein Gedicht. Der Autorname stand darüber und meine Vita stand im Autorenverzeichnis. Mein Leben haftete mit unbezweifelbarer Evidenz an der logozentrischen Subjektphilosophie. Ich war ich und setzte mich selbst, und ich war, vermöge dieses bloßen Setzens durch mich selbst: Ich war mein Sein.
Die Vollversion des Textes finden Sie im Heft