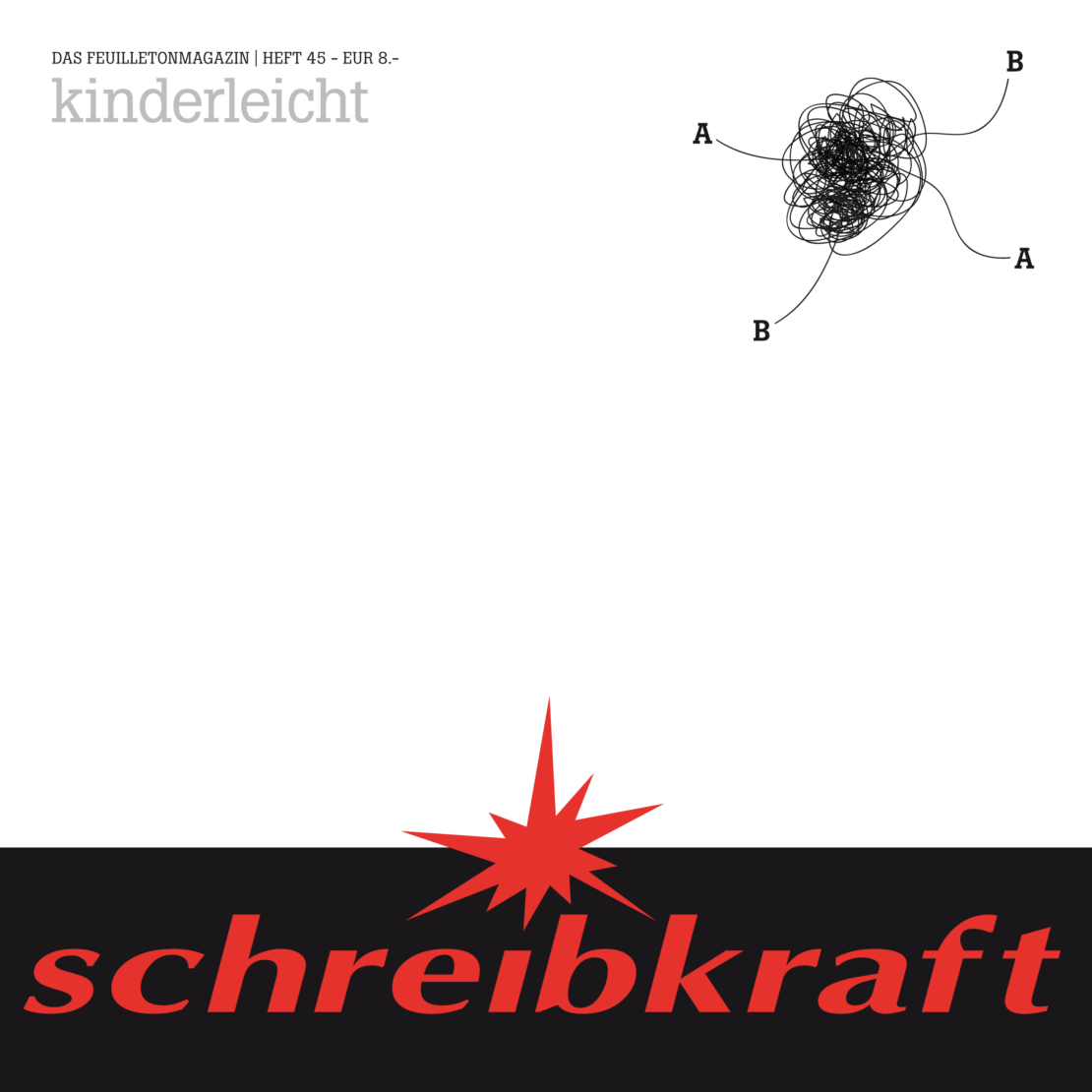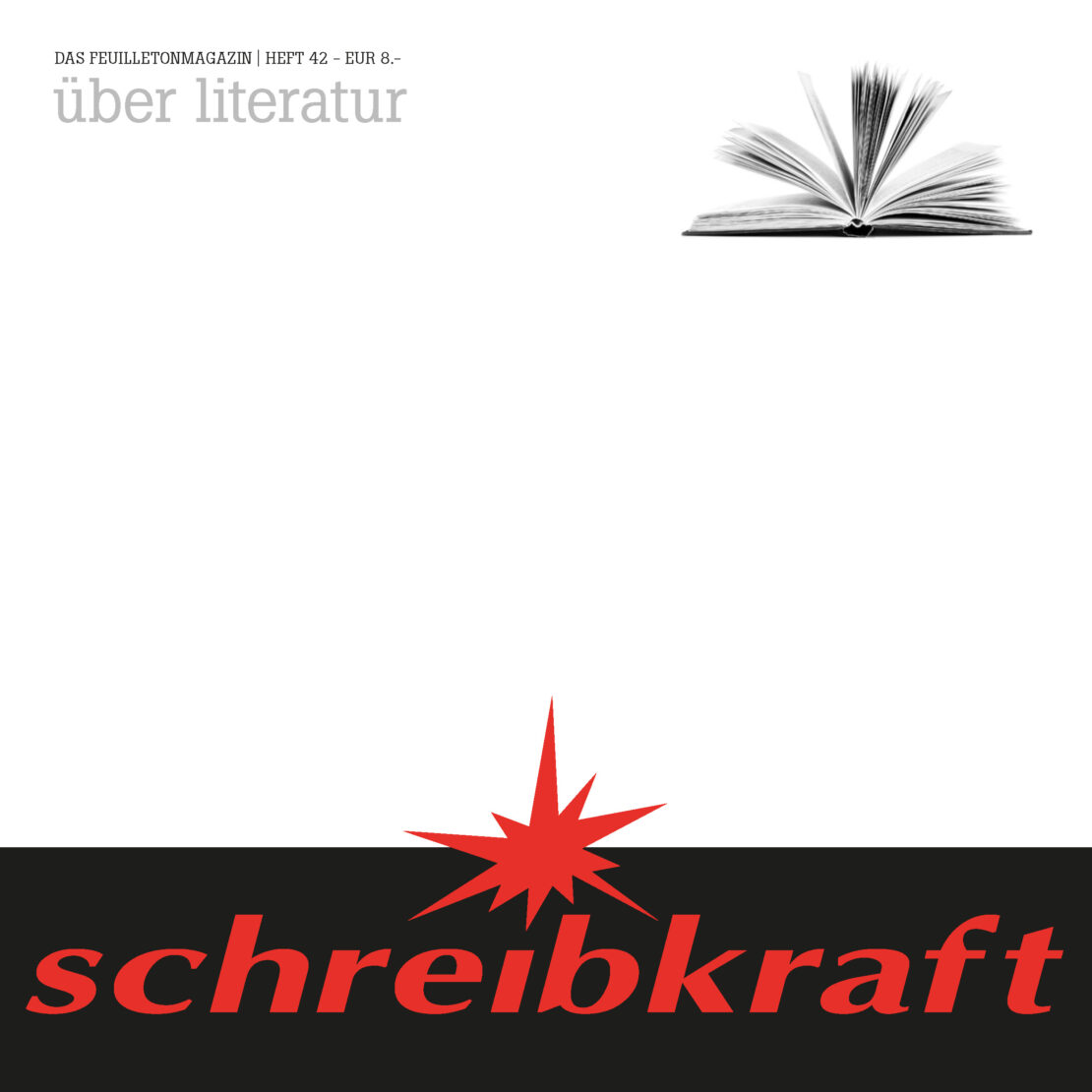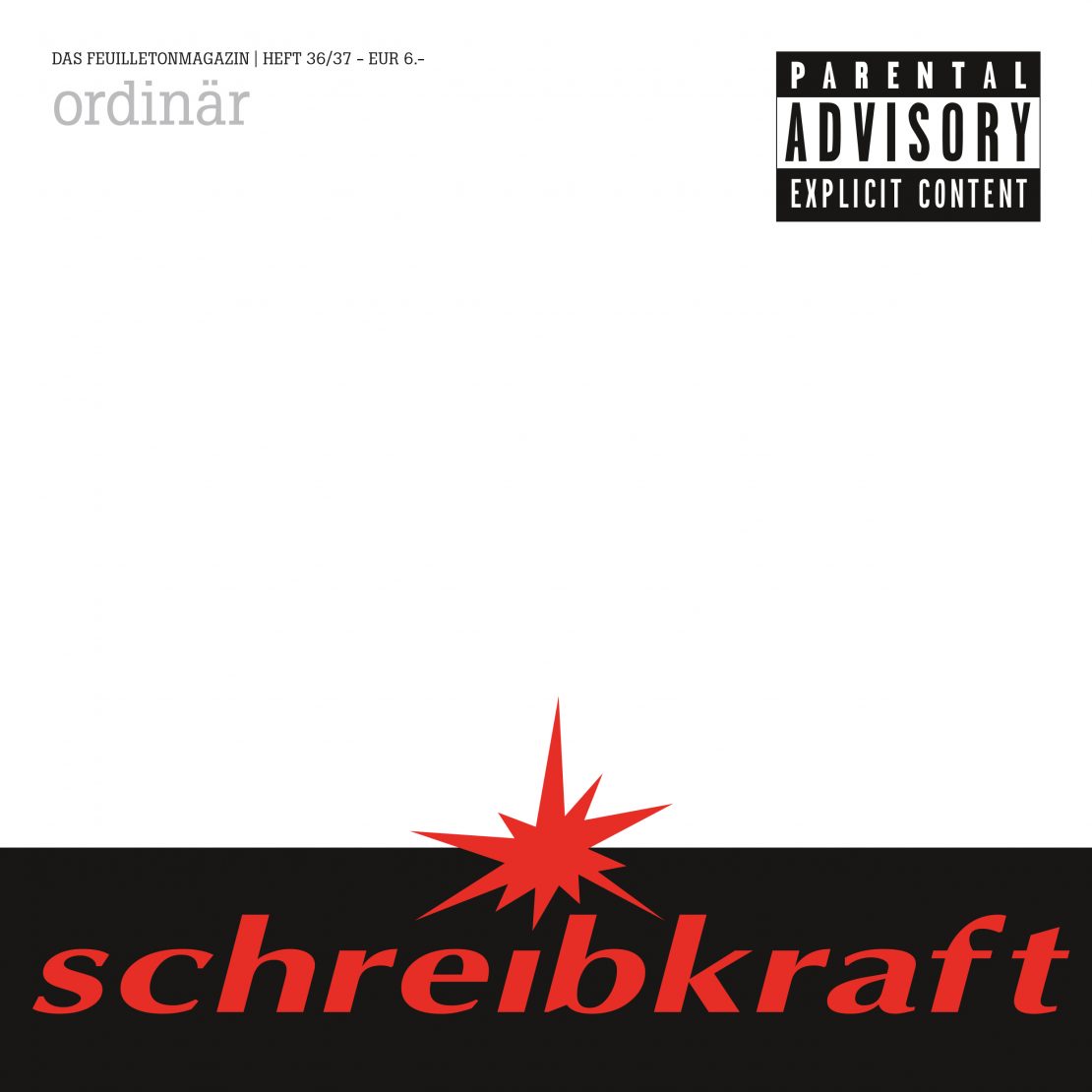Oder: Warum eröffnet man eine neue Buchhandlung in diesen Zeiten?
Lange bevor Katja Fetty und ich im Oktober 2022 o*books im Nordbahnviertel eröffnet hatten, keimte der Wunsch in mir, die Buchhandelslandschaft ein wenig zu verändern. Damals arbeitete ich in einer Grätzelbuchhandlung, wo ich in einige Prozesse miteinbezogen wurde. Unter anderem auch in die Kuration der Bücher, die am Lager sein sollten. Schon im Germanistikstudium habe ich gerne Kurse belegt, die sich mit Literatur marginalisierter Stimmen beschäftigten bzw. waren mir feministische Themen ein Anliegen. Trotz der Aneignung von Wissen zu dem Thema und der Entscheidung, künftig nur noch Literatur von Frauen*, FLINTAs allgemein, BIPoC und Queers zu lesen, und der Notwendigkeit, ebenjene Stimmen in den Vordergrund zu rücken, konnte ich auch in einem relativ liberalen und offenen Buchhandlungsumfeld nicht so walten, wie ich es mir vorstellte. Ich stellte es mir aber nicht nur für mich vor, sondern war der festen Überzeugung, es würde auch der Buchhandlung guttun, einen neuen Fokus zu setzen. Diesen Fokus konnte ich als ‚einfache‘ Angestellte nicht durchsetzen, die Begründung können wir uns vorstellen: Wir müssen Literatur für alle anbieten, selbst wenn wir Feministinnen sind, gibt es doch Kund*innen, die nicht Frauenliteratur lesen möchten. Was sollte das bedeuten? Frauenliteratur? Und warum wird sie nicht jedenfalls gleichwertig behandelt? Und die elendige Frage nach dem Huhn und dem Ei: Wer bestimmt das Angebot, wie entsteht Nachfrage, welche Parameter sind hierfür wichtig? Ich glaube, darauf kann ich an dieser Stelle keine Antwort geben, sie würde erschöpfend ausfallen (müssen) und dennoch bin ich der Meinung, dass wir uns nicht dem beugen dürfen, was vorgegeben wird, was laut Spitzentitelplatzierungen von Verlagen, Besprechungen von Journalist*innen und schlussendlich dem Kanon auf den Tischen liegen sollte.
Die Fülle an Literatur ist sehr schwer zu überblicken, zu bewältigen oder gar: zu lesen. Deshalb sind es wahrscheinlich – auch wenn sie am Schluss der Kette stehen – die Buchhandlungen, die einen enormen Einfluss darauf ausüben können, was gelesen wird und – bei allem Idealismus darf man darauf nicht vergessen – was gekauft wird. Letztendlich verdienen nicht nur Buchhandlungen und Verlage monetär daran, sondern auch die Autor*innen. Wenn aufgrund von Kanonisierung und den immergleichen Argumenten der Qualität und „Tradition“ nur ein gewisser Teil der künstlerischen Bevölkerung verdient, sei es an Geld, aber auch an Wertschätzung und Ruhm, so meine ich, sollten wir überlegen, wie dieser Ruhm verteilt werden kann, und uns fragen, wie wir das Angebot kuratieren, eben auch im Hinblick auf literarische Stimmen, die als „Nische“ gelten, vergessen werden oder beiseitegelegt.
mehr im Heft