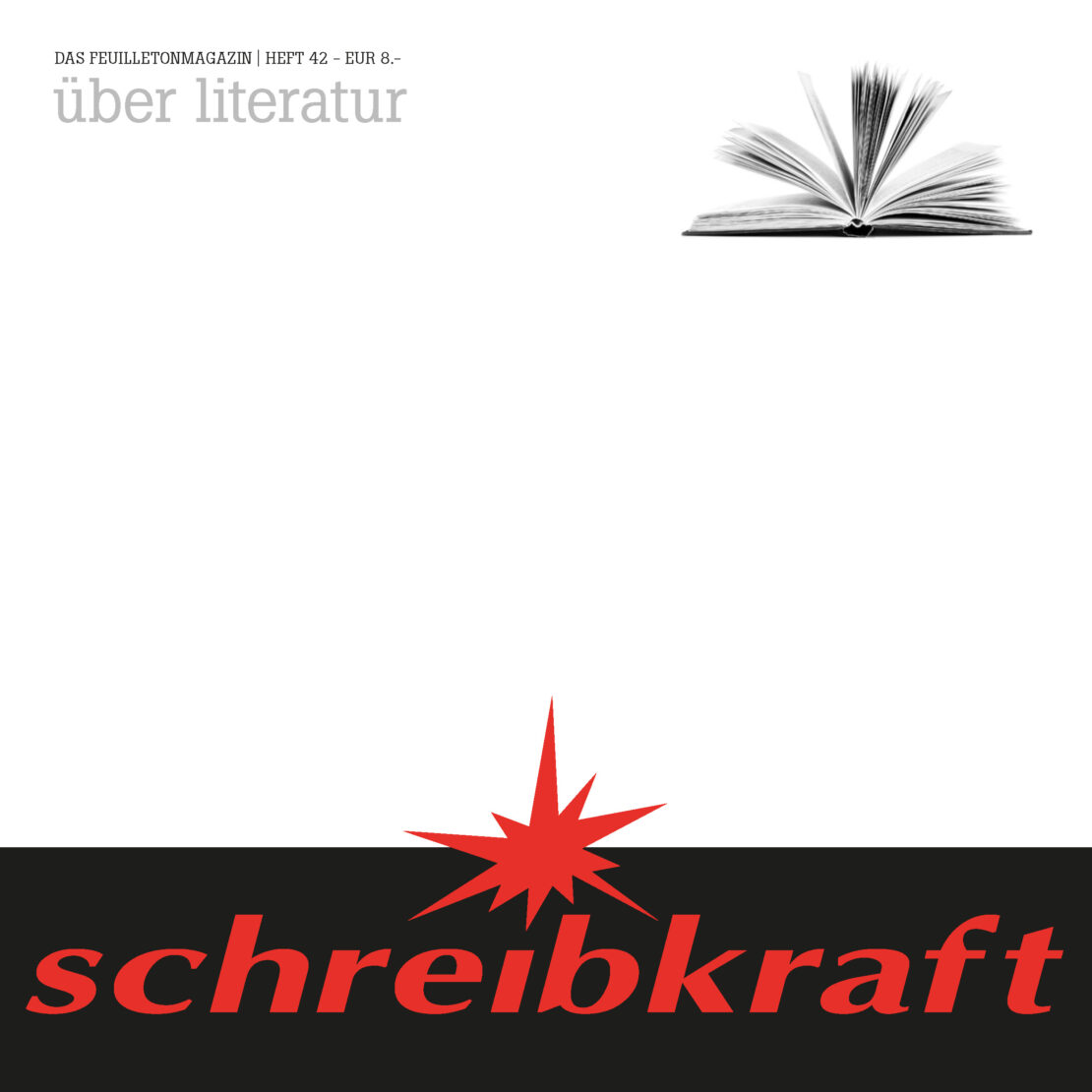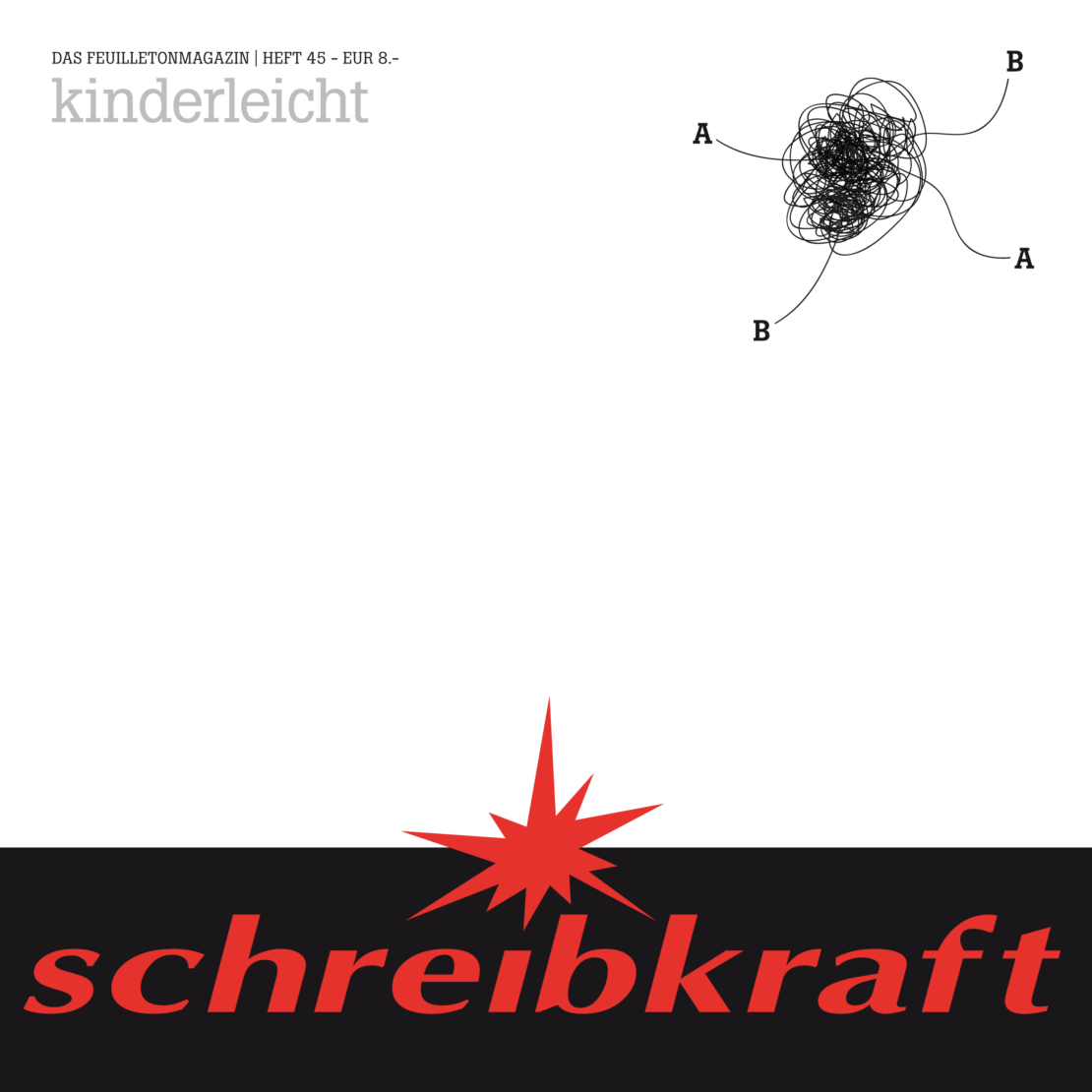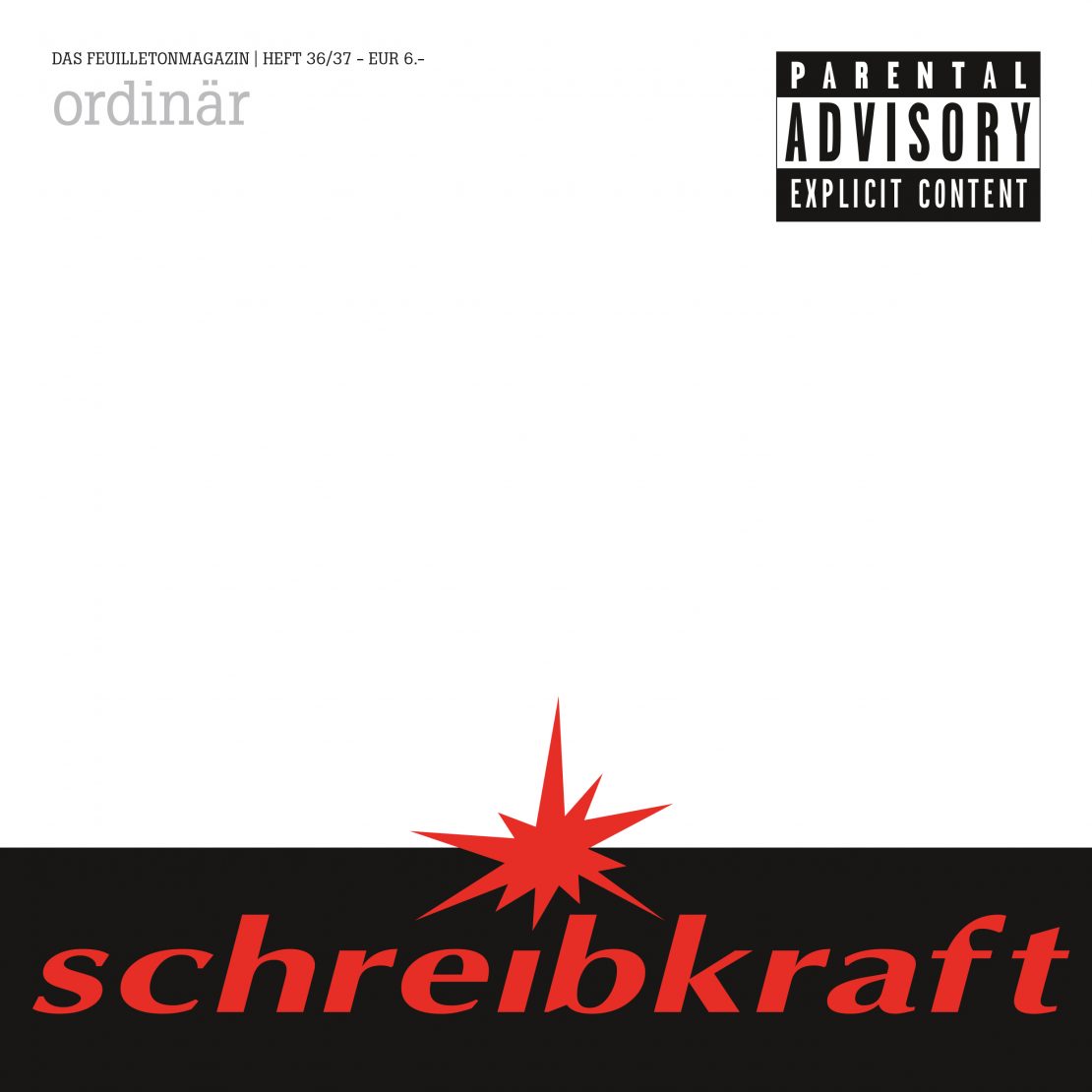Eine Exkursion.
1 Das Trugbild
Die Wirklichkeit ist eine Schimäre, resümierte vor einigen Jahren ein Rezensent der Süddeutschen Zeitung über eines meiner Bücher. Ich hätte erzählerisch darüber reflektiert, wie man vom Gegenwärtigen erzählen könne, obwohl man der eigenen Wahrnehmung misstraue. Mit diesen Worten benannte der Kritiker nicht nur ein wichtiges Anliegen der meisten meiner Romane, er rückte auch eine wesentliche Komponente von Literatur in den Fokus: die Behauptung von Wirklichkeit.
Oft wird meinen Romanen nachgesagt, sie wirkten wie gut recherchierte Reportageliteratur. Sachliche Dokumentationen wahrer Begebenheiten, gespickt mit Fakten. Doch so lakonisch der Erzählstil sein mag, was erzählt wird, ist zu guten Teilen frei erfunden. Doch Fiktion beruht unweigerlich auf Erlebtem. Auch bei überbordender Fantasie ist die Vorstellung ein Abbild vorangegangener Eindrücke. Fiktion ist nie wirklich frei, aber im Gegenzug fundiert auch der ausgeprägteste Realismus auf Interpretationen und Vorstellungen. Ist es also nie wirklich frei erdacht, was der Autor festhält, so ist es ebenso wenig wirklich wahr. Immerzu vermengt literarisches Schreiben Erfahrenes/Erlerntes mit Eingebildetem. Die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion verschwimmen. Die fiktive Erzählung wird autobiografisches Werk und jede Autobiografie wiederum fiktive Erzählung. Dem Schriftsteller kann es egal sein, er ist nicht der Beweislegung, sondern nur der Nachvollziehbarkeit verpflichtet. Bleibt er in seiner Mär plausibel, darf er Schimären erschaffen, Trugbilder, von den Fesseln des Wirklichen befreit und dennoch nicht rein auf Hirngespinsten fußend.
Die Vollversion des Textes finden Sie im Heft