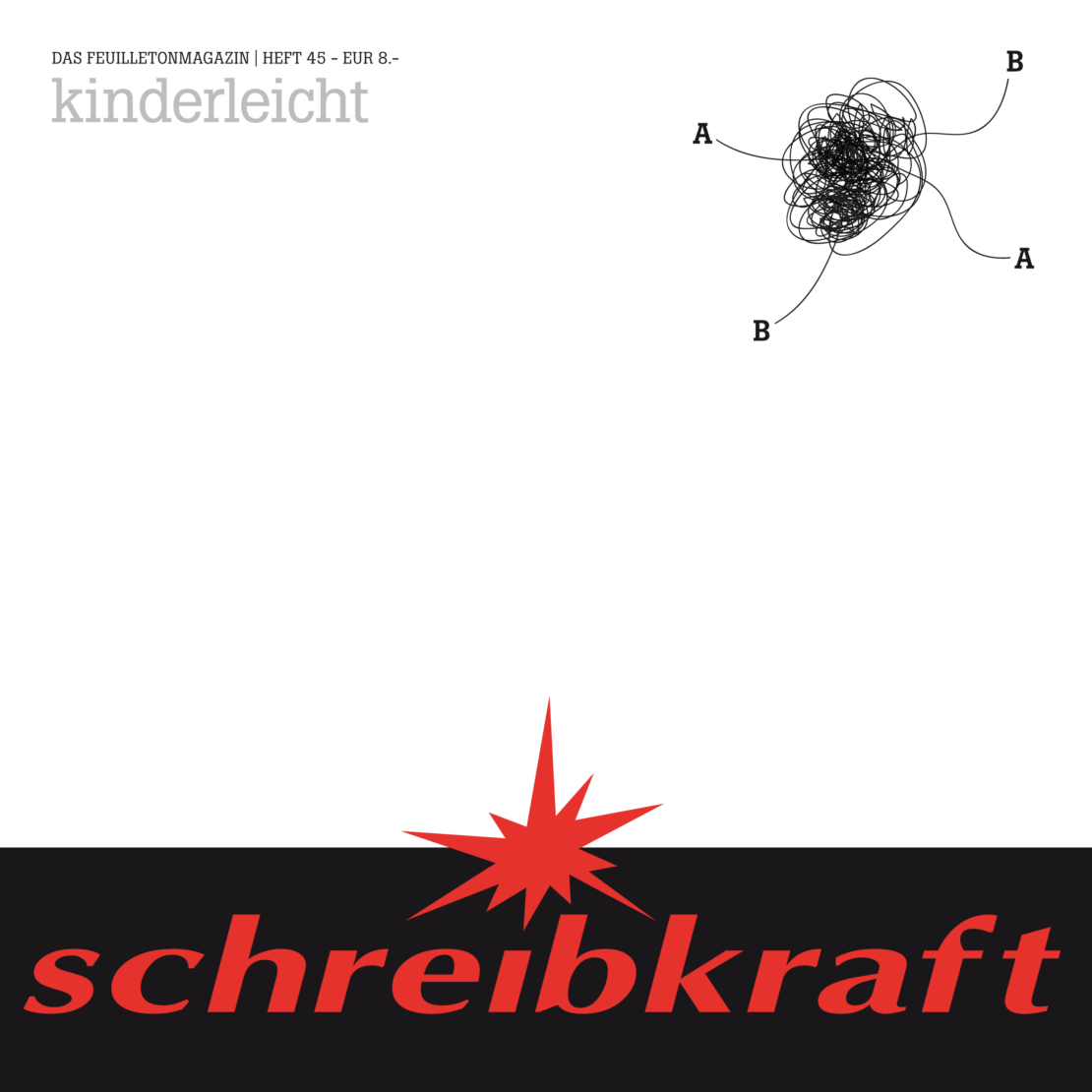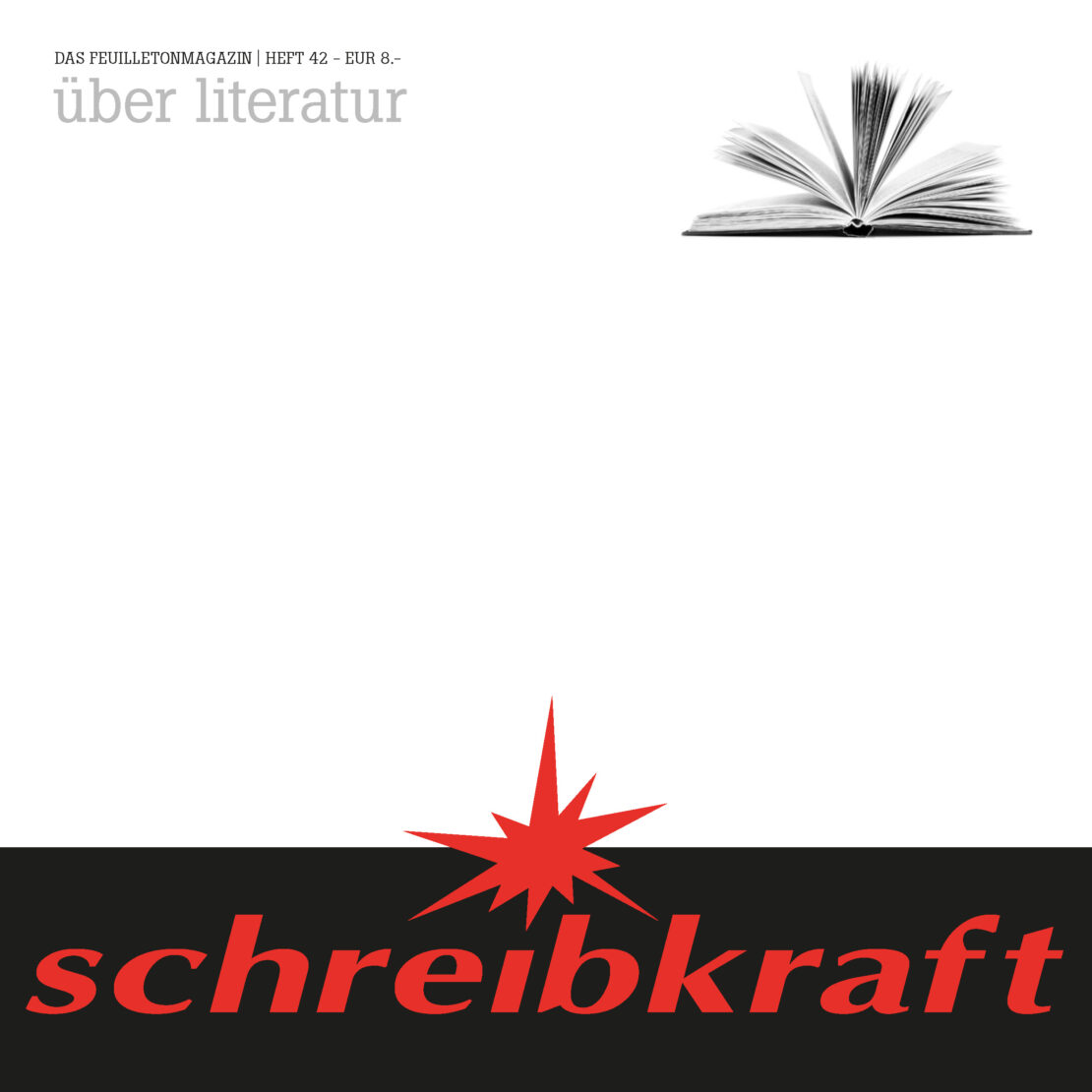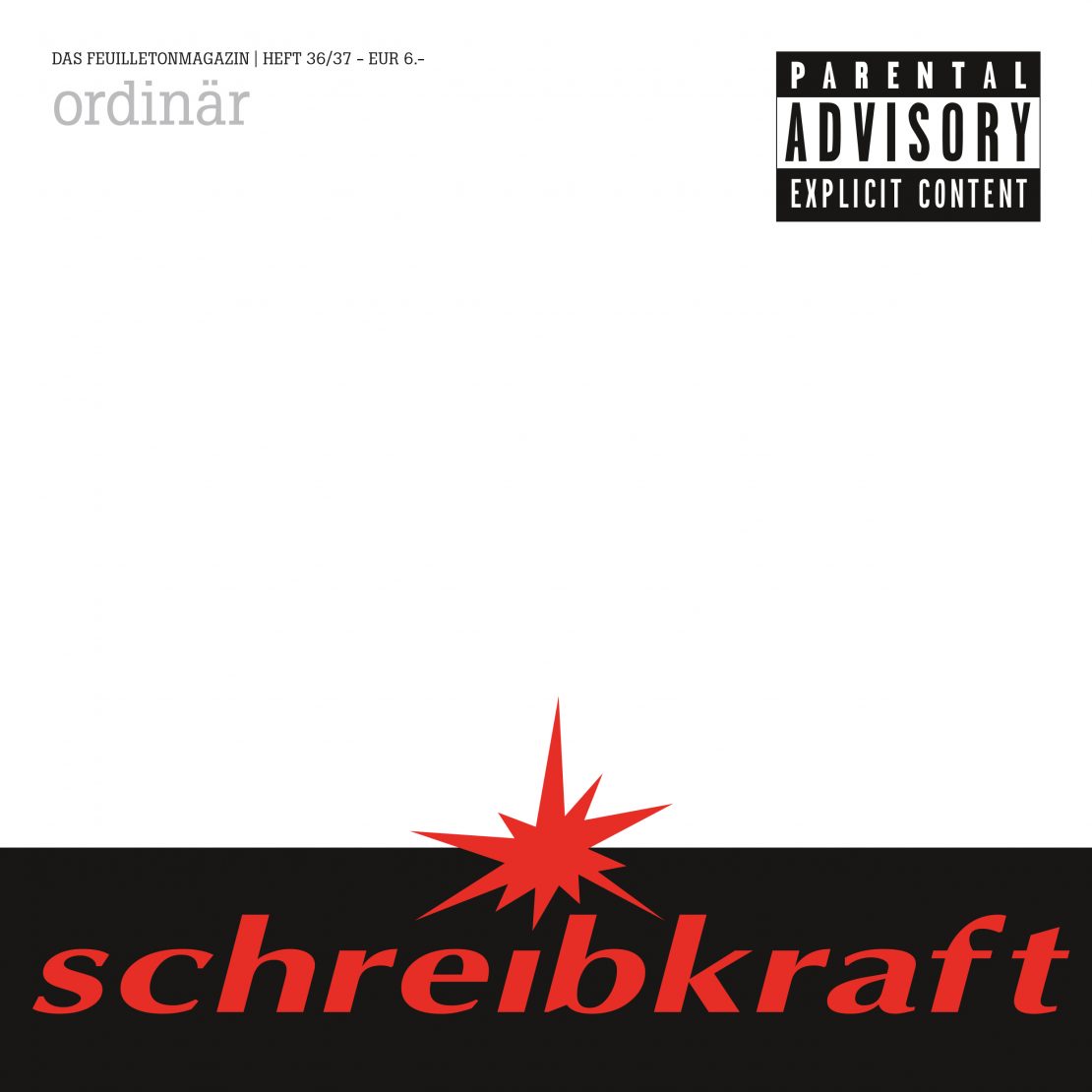Regietheater ist Geschichte. Aber die szenische Kunst glaubt immer noch an Irritationspotenz.
Das waren noch Zeiten: als Christoph Schlingensief obdachlose Menschen aus Österreich zu Säulenheiligen machte, die stoisch zusahen, wie sich wohlsituierte Passant:innen zu ihren Füßen um Geldscheine rauften, die der Regisseur auf sie runterregnen ließ (1998). Oder wie derselbe (im selben Jahr) obdachlose Menschen aus Deutschland in den Salzburger Wolfgangsee schickte, denn wenn alle kämen, die da in prekären Verhältnissen lebten, würde der See übergehen und Helmut Kohls Feriendomizil wegspülen. Oder wie er Menschen mit Migrationshintergrund, die womöglich nicht wussten, was sie da sagten, im Grazer Schauspielhaus „Tötet Wolfgang Schüssel“ skandieren ließ (2000). Ja, das waren noch die Zeiten von Helmut Kohl und Wolfgang Schüssel, von Hans Dichand und Richard Nimmerrichter. Elfriede Jelinek hieß damals nicht Nobelpreisträgerin, sondern Nestbeschmutzerin mit zweitem Vornamen.
Als beim steirischen herbst 2011 Rodrigo Garcia für sein „Gólgota Picnic“ das Ensemble über eine mit echten Hamburgern ausgelegte Bühne latschen ließ und den Pianisten Marino Formenti splitternackt ans Klavier setzte, war das eine späte Reminiszenz an das vormals so wesentliche Element der Irritation, ja Verstörung am Theater. Und die ist auch schon mehr als zehn Jahre her. Damals schon verursachte das nicht einen Hauch von Aufregung, die wahre Provokation war, dass Formenti Joseph Haydn spielte – und zwar den Klavierauszug von „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ in voller Länge. Das schien – nackt oder nicht – für viele im Auditorium kaum auszuhalten.
Die Vollversion des Textes finden Sie im Heft